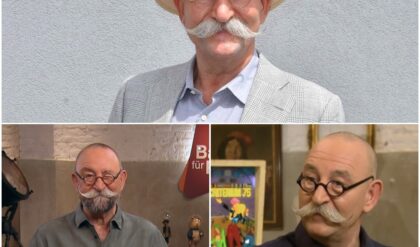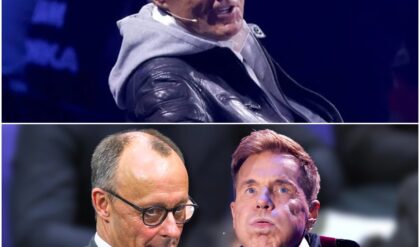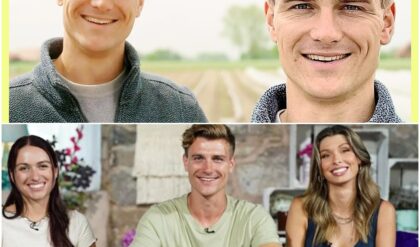In einer Gesellschaft, die das Leben feiert, wird der Tod oft zum Tabu, ein Thema, das in den stillen Ecken der Hospize und Krankenhäuser versteckt bleibt. Doch immer wieder durchbrechen prominente Stimmen diese Mauer des Schweigens und zwingen uns, über das Unausweichliche nachzudenken: wie wir sterben wollen. Die jüngsten Ereignisse um die beliebten Kessler-Zwillinge, die sich gemeinsam für den assistierten Suizid entschieden, haben das Land tief bewegt und die Debatte um die Sterbehilfe neu entfacht. Mitten in dieser emotional aufgeladenen Diskussion meldet sich eine der freimütigsten und beliebtesten Persönlichkeiten des deutschen Fernsehens zu Wort: Ina Müller.
In einem überraschend offenen und zutiefst persönlichen Bekenntnis in der Talkshow 3 nach 9 enthüllte die 60-jährige Moderatorin und Musikerin, dass sie sich intensiv mit dem Thema assistierter Suizid beschäftigt und sogar den Entschluss gefasst hat, einem entsprechenden Verein beizutreten. Ihr rationaler, aber emotional aufgeladener Appell an das Recht auf Selbstbestimmung am Ende des Lebens trifft einen Nerv in der Gesellschaft und spiegelt die Ängste vieler Menschen wider, die ihren letzten Weg nicht in Würde oder allein antreten wollen.

Der Schatten der Einsamkeit: Ein persönlicher Plan für das Ende
Ina Müller ist bekannt für ihre bodenständige Art und ihre Fähigkeit, komplexe Themen mit entwaffnender Offenheit anzusprechen. Auch beim Tod hält sie sich nicht zurück. Sie erklärte, dass das offene Sprechen über das Sterben für sie eine Notwendigkeit geworden sei. Der Kontrast zu früheren Generationen, die noch in Großfamilien lebten, ist dabei ihr zentraler Punkt: „[M]eine Oma [konnte] noch in einer Großfamilie wohnte… [sie] habe einfach sagen können, wenn ich gestorben bin, ihr seid ja da, macht, was ihr wollt“.
Für Ina Müller, die sich selbst als „wohl alleinlebende Frau in der Großstadt“ beschreibt, ist diese familiäre Geborgenheit am Ende des Lebens keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Konsequenz dieser Realität ist für sie glasklar: „Ich muss das irgendwie planen.“ Dieses kurze, prägnante Statement ist mehr als nur eine persönliche Bemerkung; es ist ein emotionaler Weckruf für Millionen von Einzelpersonen in der modernen Gesellschaft. Die Angst, am Ende des Lebens allein und unversorgt zu sein, die Kontrolle über den eigenen Körper und die eigene Würde zu verlieren, wird hier direkt angesprochen. Müller macht deutlich, dass das Planen des Todes in der heutigen Zeit eine Form der Vorsorge ist, die ebenso wichtig ist wie die Altersvorsorge oder das Testament. Es geht darum, das Ruder in der Hand zu behalten, wenn die Kräfte schwinden und die Angehörigen fehlen.
Der Kampf um die Freiheit: Leben wie sterben
Der tiefere, philosophische Kern von Müllers Argumentation liegt in der Frage der Freiheit. Sie artikulierte ihren langjährigen Unmut über die deutsche Rechtslage, die sie als inkonsequent empfindet: „Mich hat immer sehr gestört, dass wir in Deutschland das Recht haben, im Leben zu machen, was wir wollen, aber wir haben nicht das Recht, zu sterben, wie und wann wir wollen.“
Diese Feststellung ist der Schlüssel zu der gesamten Debatte. Warum sollte die Selbstbestimmung des Einzelnen an der Schwelle des Todes enden? Das Recht auf einen selbstbestimmten Tod wird von Befürwortern als logische Konsequenz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und der Menschenwürde gesehen. Es geht nicht darum, den Tod leichtfertig zu wählen, sondern darum, in extremen Situationen – sei es bei unerträglichem Leid oder bei einer als entwürdigend empfundenen Lebenssituation – eine letzte, souveräne Entscheidung treffen zu dürfen.
Glücklicherweise, wie auch Gastgeber Giovanni Di Lorenzo bemerkte, hat sich die Gesetzeslage in Deutschland seit Müllers langjähriger Frustration geändert.

Das Urteil von 2020: Eine oft unbekannte Wende
Ina Müller bestätigte die Änderung und verwies auf das historische Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020. Dieses Urteil erklärte das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung (§ 217 StGB) für nichtig und stellte damit fest, dass das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ein verfassungsrechtlich geschütztes Recht ist, das auch die Inanspruchnahme von Hilfe Dritter umfasst.
Doch Müller übte scharfe Kritik daran, dass diese juristische Wende in der Öffentlichkeit nicht ausreichend „kolportiert worden ist“. Diese fehlende Aufklärung hat zur Folge, dass viele Deutsche immer noch glauben, sie müssten den „unwürdigen“ Weg in die Schweiz antreten, um einen assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen. Ihr Plädoyer ist nicht nur ein Ruf nach persönlicher Freiheit, sondern auch eine Forderung an die Politik und die Medien, die Bevölkerung umfassend über ihre Rechte und Möglichkeiten zu informieren.
Der rationale Schritt: Mitgliedschaft im Sterbehilfeverein
Müllers Worte blieben nicht bei einer allgemeinen Forderung stehen; sie machte den Sprung zur konkreten Handlung. Sie gab an, die Satzungen eines Sterbehilfevereins durchgelesen zu haben und entschieden zu haben, dort Mitglied zu werden. Und das Bemerkenswerteste: „Egal, ob ich krank bin oder gesund, einfach da Mitglied zu sein.“
Diese Haltung unterstreicht die Idee, dass das Planen des Todes keine Reaktion auf eine akute Krise sein sollte, sondern eine proaktive Entscheidung, die Kontrolle und Frieden schafft. Die Mitgliedschaft in einem solchen Verein dient als letzter Notfallanker und als eine Art Lebensversicherung für die Würde. Sie ermöglicht es den Menschen, mit der Gewissheit zu leben, dass sie im Fall der Fälle nicht in einer qualvollen oder entwürdigenden Situation gefangen sind. Für Müller macht dies „Sinn“.
Der Appell für ein Sterben zu Hause
Der letzte emotionale Höhepunkt in Müllers Ausführungen war die vehemente Ablehnung der Reise in die Schweiz. Wenn das Leben ohnehin „sch…e“ sei, wie sie es drastisch formulierte, dann sei es zutiefst unwürdig, noch eine anstrengende und teure Reise in ein fremdes Land auf sich nehmen zu müssen. Die Möglichkeit, „zu Hause sterben“ zu können, ist für sie der Gipfel der Würde und der Selbstbestimmung.
Dies ist der humanste Aspekt ihres Arguments. Ein würdiges Ende sollte im vertrauten Umfeld, umgeben von Liebe, oder zumindest in der Sicherheit des eigenen Heims möglich sein. Der assistierte Suizid in Deutschland bedeutet, dass Betroffene in ihrer Heimat bleiben können, anstatt zu einer medizinischen Form des Exils gezwungen zu werden.

Ein Spiegel der modernen Gesellschaft
Ina Müllers ehrliche Auseinandersetzung mit dem Tod ist ein Geschenk an die öffentliche Debatte. Sie hat das Thema aus der juristischen und medizinischen Nische geholt und in den Alltag der „alleinlebenden Frau in der Großstadt“ transferiert. Ihr Bekenntnis macht deutlich: Die Frage der Sterbehilfe ist nicht nur eine Frage für todkranke Menschen, sondern eine Frage der fundamentalen Freiheit und Lebensplanung für jeden, der selbstbestimmt leben möchte – bis zum letzten Atemzug. Die Geschichte der Kessler-Zwillinge, die Hand in Hand den Tod wählten, und Ina Müllers mutiger Plan, dem Sterbehilfeverein beizutreten, werfen ein Schlaglicht auf eine der wichtigsten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit: Das Recht, über das eigene Ende zu bestimmen, muss so selbstverständlich werden wie das Recht, über das eigene Leben zu bestimmen. Die Zeit des Tabus ist vorbei; es ist Zeit für Planung, Aufklärung und Würde. Ihre Offenheit liefert einen wichtigen Anstoß, damit die rechtliche Möglichkeit des assistierten Suizids in Deutschland nicht nur auf dem Papier, sondern auch in den Köpfen der Menschen ankommt und ihnen die Gewissheit gibt, dass sie ihren letzten Weg selbst bestimmen dürfen.