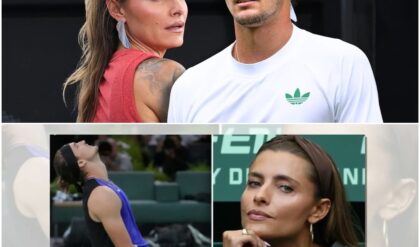Das letzte Tabu: Wolfgang Bosbach und die Fronten der Identitätsdebatte – Warum der Islam nicht zu Deutschland gehört

In der hitzigen Arena der deutschen Polit-Talkshows sind die Regeln des fairen Diskurses oft die ersten Opfer. Doch selten wurde eine Debatte so fundamental und schonungslos geführt wie die Konfrontation zwischen dem langjährigen CDU-Innenexperten Wolfgang Bosbach und einem islamischen Vertreter, der versuchte, die muslimische Gemeinschaft in Deutschland gegen vermeintliche Diskriminierung in Schutz zu nehmen. Was sich in dieser Sendung abspielte, war weit mehr als ein verbaler Schlagabtausch; es war ein Frontalangriff auf das zentrale Tabu der deutschen Identitätspolitik und eine nüchterne Abrechnung mit der Verharmlosung extremistischer Strömungen.
Bosbach, bekannt für seine unerschütterliche Sachlichkeit und seine klare Kante, legte den Finger in eine Wunde, die in den öffentlich-rechtlichen Debatten oft sorgfältig umgangen wird: die Frage nach der kulturellen und historischen Zugehörigkeit des Islam zu Deutschland und die damit verbundenen Herausforderungen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Seine Aussagen lösten eine Flut von Emotionen aus, insbesondere bei seinem Kontrahenten, doch Bosbach ließ sich nicht beirren – er blieb bei den Fakten, die viele in Deutschland denken, aber kaum jemand zu sagen wagt.
Die Macht der Tradition: Bosbachs „Nein“ zur Islam-Zugehörigkeit
Der zentrale und wiederholt vorgetragene Dissens Bosbachs betraf die politisch korrekte Formel, nach der „der Islam zu Deutschland gehört“. Der Innenexperte widersprach dieser These mit Vehemenz und historischer Klarheit: „Der Islam ist nicht Teil der Identität unseres Landes in dem Sinne wie eine christlich-jüdische Tradition. Wir haben keine islamische Tradition in Deutschland. Punkt.“
Diese Aussage ist in einem Land, das seit Jahrzehnten um einen integrativen Weg ringt, hochbrisant. Für Bosbach ist die Identität Deutschlands untrennbar mit der christlich-jüdischen Tradition verbunden, die das Grundgesetz, die Kultur, die Feiertage und die gesellschaftliche Ethik über Jahrhunderte geprägt hat. Die Existenz von vier Millionen Muslimen in Deutschland – was er niemals bestreiten würde – macht den Islam zu einer Realität in unserem Land, aber nicht zu einem kulturgeschichtlichen Fundament. Eine Gleichstellung des Islam mit dem Christentum und dem Judentum für die Geschichte Deutschlands hält er für schlicht falsch und unzutreffend. Wer dies leugne, verdrehe Geschichte, um eine aktuelle politische Ideologie daraus zu machen.
Diese Unterscheidung zwischen Realität und Identität ist entscheidend. Sie impliziert, dass die muslimische Gemeinschaft in Deutschland willkommen ist und ihre Religion in Freiheit ausüben darf, aber dass die Leitkultur und die geschichtlichen Wurzeln des Staates weiterhin in der säkularen und westlichen Tradition liegen, die aus dem christlich-jüdischen Erbe erwachsen sind.
Scharia vs. Grundgesetz: Die rote Linie der Demokratie

Die Debatte nahm eine schärfere Wendung, als Bosbach die Einschätzung des Verfassungsschutzes thematisierte. Er fragte seinen Gesprächspartner direkt, wie der Verfassungsschutz zu der Erkenntnis gelangt sei, dass die Scharia in der Praktizierung über dem Grundgesetz stünde.
Hierbei legt Bosbach den Finger auf die rote Linie der deutschen Demokratie. Solange religiöse oder politische Überzeugungen die Verfassung eines Rechtsstaates nicht in Frage stellen, sind sie geschützt. Doch die Salafisten, deren Tendenzen in der Diskussion zentral waren, stellen diese grundlegende Loyalität infrage. Bosbach wies auf eine erschreckende Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Auftreten der Islamisten in Talkshows („Sie werden in solchen Sendungen wie hier nie etwas anderes hören als das, was gerade gesagt worden ist“) und ihren tatsächlichen Botschaften hin, die in Moscheen und auf Internetauftritten verbreitet werden.
Er betonte, dass der Weg zur Radikalisierung oft harmlos beginne, etwa mit der „Verteilung von Koranbüchern“. Er stellte die entscheidende Frage: „Die Frage ist, wer tut es mit welchen Motiven?“ Die Gefahr liegt in der Infiltration und dem Missbrauch der Meinungs- und Religionsfreiheit, um ein anti-demokratisches Gesellschaftsmodell zu verbreiten. Für Bosbach ist klar: Toleranz endet dort, wo der Glaube über dem Gesetz steht.
Salafismus und Terrorismus: Ein gefährlicher Kausalzusammenhang
Einen weiteren unbestreitbaren Fakt setzte Bosbach der oft verharmlosenden Darstellung entgegen: die Verbindung zwischen Salafismus und Terrorismus. Er stellte klar: „Ich gehe noch nicht mal so weit zu sagen, jeder Salafist ist ein Terrorist, aber die allermeisten Terroristen […], darüber gibt’s ja auch gerichtsfest erhobene Beweise, hatten einmal Kontakt zu salafistischen Strömungen und haben sich dort radikalisiert.“
Diese Aussage ist eine nüchterne Feststellung der Sicherheitsbehörden. Es ist eine Warnung, dass Salafismus – eine ultrakonservative, reinigende Strömung innerhalb des Islam – ein Nährboden für Extremismus ist. Bosbachs Botschaft ist deutlich: Die politisch korrekte Weigerung, diese Strömungen offen zu benennen und zu bekämpfen, kostet letztlich die Sicherheit des Landes. Nach außen geben sich die Akteure harmlos, doch die allermeisten Terroristen kamen genau aus diesen radikalisierten Kreisen. Das ist ein Fakt, keine Hetze.
Die Tyrannei der Mehrheit: Wo Toleranz endet
Die Debatte eskalierte, als Bosbach das Problem der bedingten Toleranz ansprach. Er zitierte seinen Gesprächspartner sinngemäß mit der Aussage, dass die Rechtsordnung akzeptiert werde, „solange wir in der Minderheit sind“. Obwohl der Vertreter dies vehement abstritt, konterte Bosbach mit einer erschütternden Umkehrfrage:
„Ich beurteile den Islam nicht danach, wie er sich verhält, wenn er in der Minderheit ist. Ich beurteile ihn, wie er sich anderen religiösen Überzeugungen gegenüber verhält, wenn er in der Mehrheit ist oder gar Staatsreligion.“
Bosbach führte die Beispiele Saudi-Arabien und andere islamische Staaten an: „Warum ist es dann in Saudi-Arabien höchstens unter Lebensgefahr möglich, sich zum Christentum zu bekennen? Warum darf man in diesen Staaten, wo der Islam Staatsreligion ist, nicht eine andere Religion praktizieren?“
Seine Analyse: In der Minderheit nutzt man die Rechtsordnung gerne für die eigenen Zwecke, bleibt geschmeidig. Aber sobald man in der Mehrheit ist, endet die Toleranz gegenüber anderen Religionen. Er widersprach der Behauptung, der Islam sei die einzige Religion, die alle anderen Religionen anerkenne, und forderte den Vertreter auf, die Realität in den islamischen Staaten zu benennen. Dieser Punkt enthüllte die gefährliche Dynamik des „solange-wir-in-der-Minderheit-sind“-Prinzips und die universelle Forderung nach reziproker Toleranz.
Opferrolle vs. Realität: Die Verfolgung der Christen
Die Debatte gipfelte in der emotionalen Beschwerde des islamischen Vertreters, der beklagte, Muslime in Deutschland würden diskriminiert, fänden keine Arbeit und hätten keine Perspektiven. Bosbachs Reaktion darauf war ruhig, aber umso vernichtender.
Der Imam warf der Politik vor, „nur Gerede, Gerede, Gerede“ zu verbreiten und in Bezug auf Muslime versagt zu haben, was Bosbach als „typische Opferrolle“ abtat.
Der Innenexperte reagierte mit zwei unbestreitbaren Fakten:
-
Immigrationswelle: Warum sind Millionen Muslime in den letzten Jahren freiwillig nach Deutschland gekommen, wenn die Verhältnisse hier so „dramatisch schlecht“ sind? Die Antwort liegt auf der Hand: Deutschland bietet ihnen Freiheit und Chancen, die sie in ihren Heimatländern nicht finden.
-
Verfolgung von Christen: Bosbach entlarvte die Suggestion, Muslime seien die am meisten verfolgte Religion, als falsch und setzte mit Nachdruck entgegen: „Die verfolgteste Religion sind die Christen weltweit!“ Er betonte, dass Christen die am stärksten verfolgte Gruppe seien.
Bosbachs Schlussfolgerung war klar: Angesichts der Entfaltungsmöglichkeiten, die der Islam in Deutschland genießt – er erwähnte den Bau einer riesengroßen, wunderschönen neuen Moschee in Köln – sei es „abenteuerlich“, so zu tun, als würde der Islam diskriminiert und ausgegrenzt.
Fazit: Eine notwendige Debatte
Wolfgang Bosbach führte die Debatte nicht mit Hass, sondern mit einer kompromisslosen Loyalität zur deutschen Verfassung und zur historischen Identität des Landes. Er ließ sich nicht in die Falle der emotionalen Anschuldigungen von Rassismus oder Islamophobie locken, sondern konterte mit Fakten über Sicherheit, Geschichte und reziproke Toleranz.
Die Konfrontation enthüllte die tiefen Gräben in der deutschen Gesellschaft: Die einen fordern die bedingungslose Akzeptanz einer multi-kulturellen Realität, während andere auf der Gültigkeit der historischen Identität und der unumstößlichen Vorherrschaft des Grundgesetzes bestehen. Bosbachs „Nein“ zur Behauptung, der Islam sei Teil der deutschen Tradition, ist kein Aufruf zum Ausschluss, sondern ein Plädoyer für die klare Benennung der kulturellen Wurzeln des Staates, als Voraussetzung für eine ehrliche und erfolgreiche Integration. Diese schonungslose Abrechnung war schmerzhaft, aber längst überfällig.