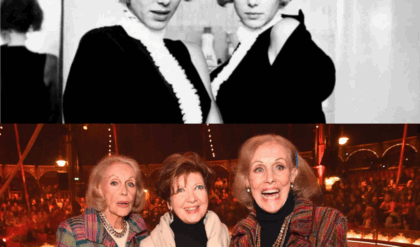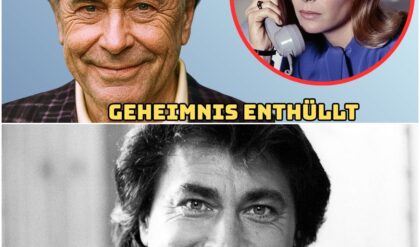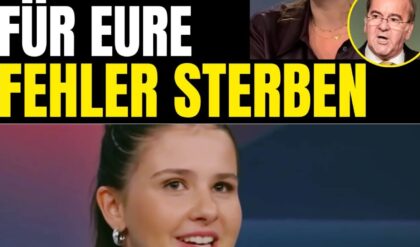Der stumme Schrei: Wie ein Polizeischuss auf ein 12-jähriges gehörloses Mädchen in Bochum eine Kette von ungelösten Fragen auslöst

Der Einsatz fand in der Dunkelheit der Nacht statt, in einem unscheinbaren Mehrfamilienhaus in Bochum-Hamme. Doch was in diesen wenigen, chaotischen Sekunden kurz nach Mitternacht geschah, hat die Republik aufgerüttelt und eine Welle von Trauer, Wut und juristischen Fragen ausgelöst. Im Zentrum dieser Tragödie steht ein zwölfjähriges Mädchen, das auf der Intensivstation um sein Leben kämpft. Es ist ein gehörloses Kind, das bei einem Polizeieinsatz durch einen oder mehrere Schüsse aus einer Dienstwaffe lebensgefährlich verletzt wurde.
Dieser Vorfall ist weit mehr als eine tragische Notwehrsituation; er ist ein brennendes Exempel für die gefährliche Konvergenz von psychischer Notlage, kommunikativen Barrieren und der blitzschnellen Entscheidung über Leben und Tod, die Polizisten in Extremsituationen treffen müssen. Er zwingt uns, über die Verhältnismäßigkeit polizeilichen Handelns und den Umgang mit den verletzlichsten Mitgliedern unserer Gesellschaft neu nachzudenken.
Die verzweifelte Suche nach der vermissten Zwölfjährigen
Die Kette der Ereignisse, die zu dem Schuss führte, begann bereits am Sonntag. Das Mädchen, dessen Identität aus Schutzgründen nicht genannt wird, lebte nicht bei ihrer Mutter, sondern in einer betreuten Wohngruppe in Münster. Dieser Umstand ist ein erster, wichtiger Hinweis auf eine komplexe familiäre Vorgeschichte, denn das Sorgerecht und das Aufenthaltsbestimmungsrecht waren der Mutter offenbar schon zuvor entzogen worden.
Als das Mädchen am Sonntag aus der Wohngruppe verschwand, wurde sofort Alarm geschlagen. Die Betreuer wussten, dass das Kind auf lebenswichtige Medikamente angewiesen war, deren Ausbleiben eine akute Gesundheitsgefährdung darstellte. Die Polizei startete daraufhin eine Großfahndung, denn jede Stunde zählte. Die Suche nach der Zwölfjährigen war von Anfang an ein Rennen gegen die Zeit, getragen von der Sorge um ihre medizinische Versorgung.
In der Nacht von Sonntag auf Montag verdichteten sich die Hinweise schließlich auf die Wohnung der Mutter in Bochum. Eine Wohnung, in der sich das Mädchen aufgrund der behördlichen Anordnung nicht hätte aufhalten dürfen. Gegen 1:30 Uhr morgens trafen zwei Streifenwagenbesatzungen – vier Beamte – vor dem Mehrfamilienhaus ein. Die Polizisten ahnten zu diesem Zeitpunkt wohl nicht, dass dieser Routineeinsatz zur Suche nach einer vermissten Minderjährigen in einer lebensgefährlichen Eskalation enden würde.
Die stumme Mauer der Kommunikation
Der Einsatzort war von Beginn an von einem tiefgreifenden Problem geprägt: der Barriere der Stille. Nach Angaben der Ermittler sind sowohl die Zwölfjährige als auch ihre Mutter gehörlos. Als die Beamten klingelten, hörten sie zwar Geräusche aus der Wohnung, aber niemand öffnete. Die Polizisten warteten auf einen Schlüsseldienst, ein zeitraubender Vorgang, der die nächtliche Spannung nur weiter erhöhte.
Doch plötzlich, mitten in der Wartezeit, öffnete die Mutter die Tür. Was in den Momenten des Zusammentreffens zwischen den uniformierten Beamten und der gehörlosen Mutter gesprochen, gezeigt oder nicht verstanden wurde, ist heute Gegenstand intensivster Ermittlungen. Die Frage nach der Kommunikation ist hier nicht nur eine technische, sondern eine zentrale juristische und moralische. Wie sollten Polizisten ihre Befehle oder Warnungen in einer Sprache vermitteln, die nur eine Minderheit der Bevölkerung beherrscht, und das in einer dynamischen, unübersichtlichen Situation? Ob die Beamten versucht haben, schriftlich oder mittels Gebärden zu kommunizieren, ist derzeit unklar. Diese Wissenslücke lässt Raum für die schreckliche Vermutung, dass das Mädchen möglicherweise gar nicht verstehen konnte, in welcher Gefahr sie sich befand.
Sekunden der Eskalation: Messer, Taser, Schusswaffe

Der Schuss fiel, als die Beamten die Wohnung durchsuchten oder betraten. Nach der offiziellen Darstellung der Polizei und Staatsanwaltschaft näherte sich die zwölfjährige Gehörlose den Einsatzkräften mit zwei Messern in der Hand. Die Polizisten, so die Darstellung, fühlten sich unmittelbar bedroht und mussten reagieren.
In solchen Sekundenbruchteilen greifen Beamte zu ihrer Waffe, um eine als unmittelbar lebensgefährlich empfundene Situation abzuwehren. Die Reaktion der zwei Beamten war unterschiedlich, was die Komplexität der Entscheidung unterstreicht: Ein Beamter setzte sein Elektroimpulsgerät, einen Taser, ein. Dieses Mittel ist zwar schmerzhaft und führt zu einer kurzzeitigen Handlungsunfähigkeit, gilt aber als nicht lebensgefährlich. Der zweite Beamte jedoch griff zur Dienstwaffe und gab einen oder mehrere Schüsse ab. Die Kugel traf das Mädchen und verletzte es lebensgefährlich.
Dieser Gegensatz – Taser versus Schusswaffe – wird nun das zentrale Element der juristischen Aufarbeitung sein. War die Anwendung der tödlichen Waffe gegen ein Kind, das psychisch offensichtlich in einer Ausnahmesituation war und durch seine Gehörlosigkeit zusätzlich vom verbalen Geschehen abgeschnitten, absolut unvermeidlich? Hätte der Taser-Einsatz des Kollegen nicht als die mildere, aber effektive Alternative ausreichen müssen, um die akute Bedrohung abzuwenden?
Die juristische Aufarbeitung und die offenen Fragen
Die Ermittlungen wurden vorsorglich an das Polizeipräsidium Essen übergeben, um die Neutralität zu gewährleisten. Eine Mordkommission untersucht nun den genauen Hergang und die Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs. Dies ist das übliche Verfahren, wenn Polizisten von ihrer Dienstwaffe Gebrauch machen und jemand schwer verletzt wird oder stirbt, doch in diesem Fall, wo das Opfer ein Kind mit Behinderung ist, ist die öffentliche und juristische Prüfung besonders intensiv.
Die wichtigsten Fragen, die nun geklärt werden müssen, sind:
-
Die Notwehrsituation: War die Bedrohung durch das Mädchen mit den Messern so unmittelbar und lebensbedrohlich, dass keine milderen Mittel – weder Taser noch körperliche Gewalt – ausreichten, um sie abzuwenden?
-
Die Kommunikationslücke: Inwieweit hat die Gehörlosigkeit von Mutter und Tochter die Eskalation beeinflusst? Hätten die Beamten vorab über spezifische Schulungen oder das Hinzuziehen eines Dolmetschers für Gebärdensprache verfügen müssen, insbesondere bei der Suche nach einer vermissten Person mit bekannten Einschränkungen?
-
Die psychische Lage: Die Zwölfjährige war vermisst, benötigte Medikamente und hielt sich illegal bei ihrer Mutter auf. War den Polizisten bewusst, dass sie in dieser emotionalen und medizinischen Ausnahmesituation handeln würde? Wie weit muss die Polizei bei der Deeskalation die psychische Vulnerabilität eines Kindes berücksichtigen?
Der Verband der Polizeigewerkschaften hat bereits betont, dass der Waffeneinsatz gegen Kinder streng geregelt sei und der Vorfall ein “extrem belastendes Ereignis für alle Beteiligten” darstelle. Diese Aussage mag die menschliche Seite der Beamten beleuchten, die selbst traumatisiert aus dem Einsatz gingen, entbindet jedoch nicht von der Notwendigkeit, die Verhältnismäßigkeit des Schusses minutiös zu prüfen.
Ein kritisches, aber stabiles Leben

Dank der schnellen medizinischen Versorgung und einer Not-Operation im Krankenhaus konnte das Leben des Mädchens gerettet werden. Ihr Zustand wurde von den Ärzten als “kritisch, aber stabil” beschrieben. Dies ist ein kleiner Hoffnungsschimmer in einem ansonsten tief dunklen Ereignis.
Doch jenseits des Krankenhausbetts wirft dieser Fall ein Schlaglicht auf die gesellschaftliche Verantwortung im Umgang mit Menschen, deren Kommunikation anders funktioniert. Das Fehlen einer akustischen Verständigung in einem Hochrisikoeinsatz führte zu einem Vakuum, das in der Hektik des Augenblicks mit einer tödlichen Waffe gefüllt wurde.
Es ist eine Mahnung an die Polizeischulen, die Notwendigkeit von interkultureller und auf Behinderung ausgerichteter Deeskalationstraining in den Fokus zu rücken. Die Stille im Leben des zwölfjährigen Mädchens hat zu einem Lärm der Gewalt geführt, dessen Echo in den kommenden Monaten in den Ermittlungsakten nachhallen wird. Die Öffentlichkeit und die Gehörlosen-Community erwarten klare Antworten darauf, ob dieser Schuss in Bochum wirklich die letzte, unvermeidliche Option war. Nur eine lückenlose Aufklärung kann das Vertrauen in die Exekutive wiederherstellen, das in dieser schrecklichen Nacht in den Bochumer Boden gesunken ist.