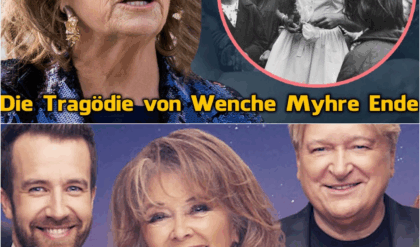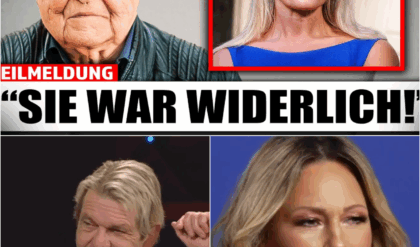Die Illusion der Unabhängigkeit: Wie “Geschmäckle” und das Weisungsrecht das Fundament des deutschen Rechtsstaats erschüttern

Der Deutsche Bundestag wurde jüngst zum Schauplatz einer hitzigen und aufschlussreichen Debatte, die das Herzstück der bundesdeutschen Demokratie betrifft: die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz. Mit scharfer Rhetorik und konkreten, brisanten Beispielen stellte der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner den amtierenden Justizminister (oder dessen Vertreter) zur Rede. Die Antworten der Regierungsbank wirkten abwehrend und bemüht, die Vorwürfe kleinzureden, doch die Fragen hallten nach: Sind die Richter und Staatsanwälte in Deutschland wirklich unabhängig, oder ist die Justiz längst zum Instrument politischer Steuerung verkommen, das dem Bürger mit “vorauseilendem Gehorsam” entgegentritt?
Der Kern des Konflikts liegt in der toxischen Mischung aus archaischen Rechtsstrukturen, parteipolitischen Seilschaften und einer unheilvollen Nähe zwischen den Gewalten. Diese Kombination, so die Anklage, erzeugt ein “bitteres Geschmäckle” in einem Rechtsstaat, der auf Transparenz und Distanz basieren sollte, aber zunehmend den äußeren Eindruck der politischen Gefügigkeit erweckt.
I. Das Brisante Weisungsrecht: Der “Oberste Staatsanwalt” der Politik
Die erste und grundlegendste Attacke Brandners zielte auf das sogenannte Weisungsrecht über die Staatsanwaltschaften – ein Prinzip, das in den Paragrafen 146 und 147 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) verankert ist. Dieses Recht erlaubt es den Justizministern der Länder und des Bundes, den Staatsanwälten Anweisungen in Einzelfällen zu erteilen.
Brandner brachte die Realität auf den Punkt: Der jeweilige Justizminister eines Landes ist faktisch der “oberste Staatsanwalt” und damit Weisungsgeber. Diese Konstellation widerspricht fundamental dem modernen Verständnis von richterlicher und staatsanwaltschaftlicher Unabhängigkeit, wie sie in vielen anderen europäischen Rechtsstaaten praktiziert wird.
Der Abgeordnete konfrontierte die Regierungsbank mit konkreten, öffentlichkeitswirksamen Fällen, die den Verdacht des “vorauseilenden Gehorsams” nähren:
- Der Fall Norbert Bolz: Der bekannte Medienwissenschaftler erhielt morgens Besuch von der Staatsanwaltschaft, nachdem er die “Taz” mit einem “Nazispruch” konfrontiert hatte. Die Justiz ermittelte hier gegen einen kritischen Intellektuellen wegen einer Meinungsäußerung, die in eine politische Debatte fiel.
- Die Bamberger Justiz: Diese agiere bei Fällen von “Politikerbeleidigung” mit bemerkenswerter Schnelligkeit und Härte, während sie bei anderen Delikten oft zögerlicher sei.
- Der Fall des Kanzlers: Die Bayreuther Justiz (vermutlich ein Fehler für die Bayreuther, die den Fall bearbeiteten) stellte die Äußerungen des Bundeskanzlers in die Tradition des NS-Jargons.
Diese Beispiele, so Brandner, zeigen eine “absolut politische Willfährigkeit” in Teilen der Justiz. Die Staatsanwaltschaft weiß um die Weisungsgebundenheit und agiert möglicherweise aus Angst oder Kalkül.
Das Traurige daran: Sogar der Vorgänger im Amt (Herr Buschmann, FDP) hatte die Notwendigkeit einer Reform des Weisungsrechts erkannt und angegangen. Die aktuelle Regierung jedoch weigert sich, hier nachzuziehen oder gar eine komplette Unabhängigkeit herzustellen. Das Festhalten an dieser archaischen Struktur erzeugt den Eindruck, dass die Exekutive die Judikative als ihr verlängerter Arm betrachtet, um unliebsame Stimmen zu disziplinieren und politische Interessen durchzusetzen.
II. Die Illusion der Richterwahl: Parteibuch statt Unabhängigkeit
Die Debatte verlagerte sich schnell vom Staatsanwaltswesen zum höchsten deutschen Gericht: dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Die Regierungsvertreter beteuerten, die Richterwahl sei frei von politischer Einflussnahme und diene der Findung “höchstqualifizierter Richterinnen und Richter”.
Brandner zerlegte diesen Anspruch mit Verweis auf die knallharte politische Realität:
- Das Faktische Benennungsrecht: De facto sind die acht Sitze pro Senat im BVerfG unter den Parteien aufgeteilt: dreimal CDU/CSU, dreimal SPD, einmal Grüne und einmal FDP (zum Zeitpunkt der Rede).
- Die Garantie der Parteien: Die Partei, die das Vorschlagsrecht hat, besitzt eine Garantie, dass ihr Kandidat in 99,9% der Fälle auch gewählt wird.
Die Wahl der Verfassungsrichter, die im Plenum eine Zwei-Drittel-Mehrheit erfordert, ist in der Praxis oft nur die Zementierung eines parteipolitischen Deals. Die angebliche Notwendigkeit einer “breiten Zustimmung” dient laut AfD nicht der Findung der besten juristischen Köpfe, sondern der Auswahl von Personen, die dem politischen Spektrum der Regierungsfraktionen genehm sind. Die Unabhängigkeit des Gerichts wird damit schon im Auswahlverfahren konterkariert. Das Demokratie- und Repräsentationsprinzip wird ad absurdum geführt, wenn nur Richterkandidaten zur Wahl zugelassen werden, die zuvor zwingend die Zustimmung der Regierungsfraktionen erhalten haben.
III. Das Bittere Geschmäckle: Geheime Abendessen und die Angst vor dem Verbot
Der Gipfel der Vorwürfe betrifft die unheilvolle und intransparente Nähe zwischen den Gewalten. Der AfD-Abgeordnete stellte die bohrende Frage nach den wiederholten privaten Abendessen von Regierungsmitgliedern mit Richtern des Bundesverfassungsgerichts.
Diese Treffen, die abseits der Öffentlichkeit in vertraulichen Runden stattfinden, sind in einem Rechtsstaat, der auf Transparenz und Gewaltenteilung beruht, mehr als nur ein symbolischer Fehltritt. Der Abgeordnete fragte zu Recht, ob alleine der äußere Eindruck nicht die gebotene Distanz vermissen lasse und die Gefahr einer möglichen Einflussnahme auf zukünftige Entscheidungen bestehe.
Die Schlussfolgerung, die der Redner indirekt in den Raum stellte, ist explosiv: Worüber wird bei diesen Treffen gesprochen? Steht hier möglicherweise ein AfD-Verbot auf der Agenda, ein Thema, das in Regierungskreisen immer wieder diskutiert wird? Das Schweigen der Regierungsbank über die Inhalte dieser Gespräche ist lauter als jede Aussage und vergiftet das Vertrauen der Bürger.
Die Gewaltenteilung ist kein dekoratives Prinzip; sie ist die Lebensversicherung der Demokratie. Wenn die Exekutive die Judikative in vertraulichen Runden konsultiert, verschwimmen die Grenzen dort, wo Kontrolle herrschen sollte. Es entsteht der Eindruck, dass jene, die die Macht innehaben, zugleich die Kontrolle suchen, und das ist inakzeptabel.
IV. Die Rhetorik der Rechtfertigung: Flucht in die Gesetzesbindung
Die Regierungsbank verteidigte sich mit der Rhetorik der juristischen Selbstverständlichkeit. Der Staatssekretär beteuerte:
- Die Justiz sei unabhängig und arbeite auf Grundlage von Gesetzen.
- Das Weisungsrecht dürfe nur im Rahmen der Gesetze Gebrauch gemacht werden und sei der parlamentarischen Kontrolle unterworfen.
- Die Kontakte mit Verfassungsrichtern seien normaler “Austausch” und keine unangemessene Beeinflussung.
Diese Verteidigung ist jedoch unzureichend, weil sie die politische und psychologische Dimension der Vorwürfe ignoriert. Wenn die Justiz mit vorauseilendem Gehorsam handelt, nützt es wenig, wenn die Weisungsbefugnis theoretisch juristisch überprüfbar ist. Das Problem liegt im Glaubwürdigkeitsverlust des Systems, nicht in der reinen juristischen Legalität.
Gerade in Zeiten, in denen es Hausdurchsuchungen bei kritischen Bürgern und Ermittlungen wegen Meinungsäußerungen gibt, wo ist der Aufschrei des Justizministers für jene, die nur von ihrem Grundrecht auf freie Meinung Gebrauch machen? Eine Justiz, die das Vertrauen der Bevölkerung erhalten will, muss mutig und transparent sein, nicht gefügig und taktisch.
Fazit: Das Auseinanderbrechen des Gleichgewichts
Die Kombination aus dem Weisungsrecht, dem parteipolitisch durchdrungenen Richterwahlverfahren und den intransparenten Treffen auf höchster Ebene erzeugt ein systemisches Problem, das das Gleichgewicht der Demokratie bedroht.
Die Bürger fragen sich zu Recht, ob die Elite nicht wichtigere Aufgaben hat, als sich zu heimlichen Abendessen mit den Kontrollinstanzen zu treffen, während die sozialen und wirtschaftlichen Probleme des Landes brennen. Transparenz ist keine lästige Pflicht, sie ist die Lebensversicherung des Rechtsstaates.
Die politische Klasse verliert die Distanz zur Justiz und damit der Staat die Distanz zur Wahrheit. Ohne klare Trennung von Macht und Kontrolle verliert die Demokratie ihr Fundament. Das “bittere Geschmäckle” von parteipolitischer Willfährigkeit und heimlichen Absprachen ist mehr als ein Detail; es ist ein Symptom einer Demokratie, die sich selbst nicht mehr vertraut. Nur eine kompromisslose Reform des Weisungsrechts und eine radikale Öffnung der Richterwahlverfahren können das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz wiederherstellen und den deutschen Rechtsstaat vor dem finalen Gleichgewichtsverlust bewahren. Der Appell der AfD ist ein unmissverständlicher Weckruf: Die Politik muss verstehen, dass Glaubwürdigkeit nicht in Gesprächen mit Richtern wächst, sondern im ehrlichen Dialog und der strikten Distanzierung von der Judikative.