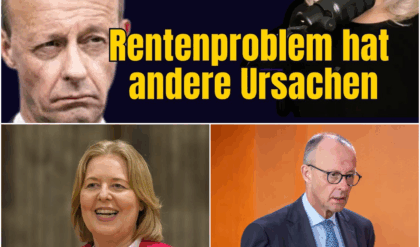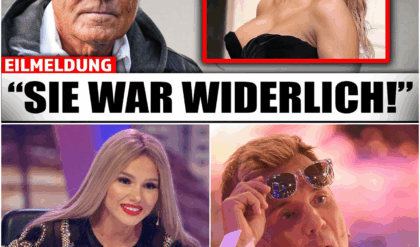Die letzte Bastion der Vernunft: Franz Münteferings eiskalte Analyse der SPD-Krise und sein unbeugsames Plädoyer für Wehrhaftigkeit und Menschlichkeit

Franz Müntefering, der 85-jährige Großmeister der Sozialdemokratie und einer der prägendsten Politiker der Bundesrepublik, hat in einem tiefgreifenden Interview eine Bestandsaufnahme der deutschen Politik geliefert, die von Klarheit, Enttäuschung und unbeugsamer Überzeugung zeugt. Der ehemalige SPD-Vorsitzende und Vizekanzler, bekannt für seine knappen, oft zitierte Sätze wie „Opposition ist Mist“, entzieht sich dem Altersruhestand mit einer analytischen Schärfe, die seine eigenen Genossen ebenso herausfordert wie das gesamte politische Spektrum.
Sein Credo ist dabei so einfach wie unpopulär: Politik muss nicht gefallen, sie muss notwendig sein. Und im Angesicht globaler Unsicherheiten, einer flüchtenden SPD und dem Aufstieg autoritärer Tendenzen ist es für Müntefering Zeit für Wahrhaftigkeit. Seine Botschaft ist ein Appell an Mut, Disziplin und die sozialdemokratischen Grundwerte, die er auch dann verteidigt, wenn sie Wählerstimmen kosten.
Die kalte Dusche für die SPD: Kritik an Motto und Mutlosigkeit
Die jüngsten Wahlergebnisse und der Zustand seiner Partei, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), sind für Müntefering Anlass zu tiefster Sorge, aber auch zu einem ungeschminkten Urteil. Er gesteht offen ein, dass die SPD in einer Krise steckt, die teilweise hausgemacht ist, aber auch ein Symptom der allgemeinen Verunsicherung in Deutschland und der Welt darstellt. Er beobachtet zwar mit Freude, dass viele junge Menschen und Frauen auf dem Parteitag Verantwortung übernehmen wollen, doch er sieht eine grundlegende strategische und kommunikative Schwäche.
Seine Kritik entzündet sich an Details, die für ihn das große Ganze verraten. So moniert er das Parteitagsmotto „Veränderung beginnt mit uns“ als zu unkonkret und ohne klares Ziel. Noch schärfer kritisiert er die Formulierung „Das Soziale ist für dich“ als eine „Ego-Formulierung“, die der sozialdemokratischen Idee des Kollektivs und der Solidarität völlig fremd sei. Eine Partei, die für Verteilungsgerechtigkeit kämpft, müsse von „für uns“ oder „für alle“ sprechen, nicht von einem individualistischen „für dich“.
Der Altmeister, der selbst morgens eiskalt duscht und dabei bis zu 150 zählt, um seinen „Dickkopf durchzusetzen“ und „den Tag richtig anzufangen“, fordert diese Disziplin auch von seiner Partei. Die SPD müsse Stabilität zeigen und ein Konzept entwickeln, das „über Jahre und auch Jahrzehnte geht.“ Er freut sich, dass Persönlichkeiten wie der Parteivorsitzende Lars Klingbeil nach der letzten Bundestagswahl die Verantwortung übernommen haben und lobt dessen Fähigkeit, die „Truppe“ wieder arbeitsfähig zu machen. Auch Bärbel Bas, die er sich einst als Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen gewünscht hatte, verkörpere die Authentizität, die der Partei so oft fehle: Politiker müssten so sprechen, dass die Menschen einen direkten Bezug zu ihrem Leben herstellen können – weg von Technik, Prozenten und Kommazahlen.
Die Unverzichtbarkeit der Unpopularität: Die Verteidigung der Agenda 2010
Franz Müntefering ist untrennbar mit den unpopulärsten und gleichzeitig wohl wirkungsmächtigsten Reformen der jüngeren deutschen Geschichte verbunden: der Agenda 2010 und der Rente mit 67. Bis heute verteidigt er diese Entscheidungen unerschütterlich.
Er betont, dass es sich dabei nicht um einen Verrat an sozialdemokratischen Idealen, sondern um eine nüchterne Notwendigkeit gehandelt habe. Die Entscheidungen seien logisch gewesen, getragen von der simplen Arithmetik: „Volksschule Sauland: 1 und 1 ist 2.“ Aufgrund der demografischen Entwicklung – älter werdende Menschen, die länger Rente beziehen, und jüngere Menschen, die später in den Beruf einsteigen – stimmte die Rechnung in den sozialen Sicherungssystemen nicht mehr. Die Entscheidung zur Rente mit 67 war für ihn ein Muss, um das System langfristig zu finanzieren.
Die Agenda-Reformen, die zur Gründung der Linkspartei führten und die SPD lange lähmten, betrachtet er rückblickend als essenziell für die Stabilität des Landes und die Senkung der Arbeitslosigkeit. Die damaligen Entscheidungen waren zwar „unpopulär“ und wurden von Massendemonstrationen begleitet, doch sie seien im „Rahmen des Möglichen“ das Beste gewesen, um Arbeitsplätze zu sichern und das Land stabil zu halten.
Seine Philosophie lautet: „Man darf seine Politik nicht danach ausrichten, was muss ich tun, damit die Leute mich wählen, sondern was müssen wir tun, damit die Menschen menschenwürdig hier leben können.“ Er wünscht sich, dass die SPD wieder den Mut aufbringt, auch unpopuläre, aber notwendige Entscheidungen zu treffen und diese den Menschen ehrlich zu erklären, anstatt „Illusionen zu verbreiten“.
Migration, Menschlichkeit und die Bedrohung der Menschenrechte
Die wohl emotionalsten Passagen widmet Müntefering dem Thema Migration und Integration. Er kritisiert die aktuelle politische Debatte, die in Deutschland und in Europa fast ausschließlich von Abweisung, Zurückweisung und Abschiebung geprägt sei, während das Wort Integration kaum noch falle. Für ihn ist dies eine verheerende Kurzsichtigkeit angesichts eines „Weltthemas“, das in den nächsten Jahrzehnten nur noch an Bedeutung gewinnen wird.
Müntefering erinnert sich an seine Kindheit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als Menschen aus Ostdeutschland und Polen als „Flüchtlinge“ in sein katholisches Heimatdorf kamen. Er erzählt die Anekdote, wie aus ideologischen Gründen eine eigene evangelische Schule für nur 30 bis 40 evangelische Kinder eingerichtet wurde, während 500 katholische Kinder eine große Schule besuchten. Diese „fürchterliche“ Erfahrung der Abgrenzung aufgrund von Konfessionen, die ihn schon als kleinen Jungen beschäftigte, dient ihm heute als mahnendes Beispiel für die Fehler im Umgang mit Zuwanderung.
Er fordert eine Abkehr von dieser Kleinstaaterei: „Wir müssen uns dafür zu werben, dass wir ein Teil dessen, was wir bei uns im Lande haben, dass wir das auch teilen mit Menschen, die zu uns kommen.“ Es gehe darum, die Zuwanderer zu qualifizieren, zu integrieren und ihnen eine echte Chance auf ein menschwürdiges Leben zu geben, anstatt sie in überforderten Kommunen und Unterkünften hängen zu lassen.
Besonders alarmierend ist für ihn die Entwicklung in Europa, wo selbst sozialdemokratische Regierungschefs wie Mette Frederiksen in Dänemark eine restriktive Politik verfolgen und gemeinsam mit Akteuren wie Giorgia Meloni die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) infrage stellen. Für Müntefering ist der Grundsatz „alle Menschen gleich viel wert“ die „entscheidende Formel“ der Nachkriegszeit. Wer an diesem Grundsatz rüttelt, lädt „eine große Schuld auf sich“. Diese Entwicklung, so Müntefering, sei „unerfreulich“ und ein gefährlicher Pfad, den seine SPD mit aller Macht bekämpfen müsse.
Die unbeugsame Forderung: Das AfD-Verbot als „Pflicht“
Die größte Gefahr für die deutsche Demokratie sieht Müntefering im Aufstieg der AfD. Hier zeigt er keine Spur von Kompromissbereitschaft oder taktischer Zurückhaltung. Obwohl er davor warnt, die Partei täglich zu „beschimpfen“, ist er überzeugt, dass das bloße Aussitzen der Gefahr nicht ausreicht.
Seine Haltung zur Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens ist unmissverständlich: „Ich bin zunächst mal dafür, dass man den Antrag stellt.“ Er betrachtet dies nicht als politische Option, sondern als eine „Pflicht, die sich aus dem Grundgesetz ergibt.“ Das Grundgesetz, so Müntefering, fordert die Bürger und das Parlament nicht nur auf, demokratisch zu sein, sondern auch, die „Zerstörung der Demokratie zu verhindern.“
Wenn der Bundestag davon überzeugt ist – und Müntefering ist es –, dass die AfD darauf aus ist, das demokratische System zu „schleifen“, dann müsse er handeln und den Antrag beim Bundesverfassungsgericht stellen. Auch das Argument, dass ein Scheitern das Gericht stärken würde, lässt er nicht gelten. Es sei an der Zeit, „um Punkt gebracht zu werden“. Er drängt die Koalition, diesen „Juckepunkt“ anzugehen, da man sich nicht zu lange hinter dem Warten verstecken dürfe.

Wehrhaftigkeit und Europas globale Rolle
Die außenpolitische Dimension der Krise ist für Müntefering eng mit der Frage der Wehrhaftigkeit verbunden. Er diagnostiziert eine „sehr kritische Situation“ für Europa, das im „Gehänge zwischen Amerika und Russland“ zu schwach sei.
Angesichts der „aggressiven Position“ Putins, der die Ukraine nicht als hinreichend angesehen habe und dessen Machtstreben nicht bei Polen ende, müsse Deutschland und Europa handeln. Obwohl Müntefering den Krieg zutiefst verabscheut und ihn als „ganz entsetzlich“ beschreibt, bejaht er die Notwendigkeit zur Aufrüstung und die Bereitschaft, dafür „viel Geld auszugeben“. Dies sei das einzige Mittel, um Putin glaubhaft die „Grenzen“ aufzuzeigen und klarzustellen, dass man „wehrfähig“ sei.
Er unterstützt Boris Pistorius’ Kurs und geht sogar so weit, die Wiedereinführung des Wehrdienstes oder eines allgemeinen Dienstes als notwendig zu erachten. Dies sei keine „Jungsache“ oder „Männersache“, sondern eine Aufgabe, die auch junge Frauen gleichermaßen betreffe. Die „Drohung“ der Wehrhaftigkeit müsse realistisch sein, damit Putin sieht, dass „er keine Chance hat, uns auseinanderzureden“.
Seine größte Sorge gilt dabei dem „Schutzpatron“ USA. Angesichts der „super gefährlichen“ Haltung von Donald Trump, dessen Wiederwahl die Welt verändern würde, ist Müntefering beunruhigt: Ein Rückzug der USA würde Putin den „Freibrief“ geben, in Europa „richtig loszumachen“. Deshalb müsse Deutschland, auch wenn es ihn nicht glücklich mache, die militärische Stärke aufbauen, um jederzeit handlungsfähig zu sein.
Das Vermächtnis des Kämpfers: „Geh’n morgen aufstehen“
Franz Münteferings Philosophie des Lebens und der Politik ist ein Spiegelbild seiner Kriegserfahrungen als Kind und der Lektionen seines Vaters: „Keine deutschen Stiefel im Ausland“ – aber wenn man helfen muss, dann muss man dafür sorgen können.
Der Altmeister schöpft seine Widerstandskraft aus seiner tiefen Überzeugung und seiner eigenen Lebenseinstellung: Er hat keine Angst vor dem Tod, der nur ein „ganz kurzer Augenblick“ sei, sondern vor der Lustlosigkeit im Leben. Sein Credo für das Altwerden und für die Politik lautet: „Geh’n morgen aufstehen.“
Diese Haltung ist das, was er der SPD und der gesamten Gesellschaft mitgibt. Er ruft dazu auf, sich nicht von der „simplifizieren“ Medienlogik und der Flucht in einfache Antworten beherrschen zu lassen. Müntefering ist der lebende Beweis dafür, dass Politik ein anstrengendes, oft undankbares, aber notwendiges Handwerk ist, das nur durch Mut, harte Arbeit und die unerschütterliche Loyalität zum Wohle des Volkes gelingt. Sein Appell ist ein Auftrag zum Handeln: Denn nur wer bereit ist, für die Demokratie zu kämpfen und dafür einzustehen, dass „alle Menschen gleich viel wert“ sind, kann die Begeisterung für Politik neu entfachen.