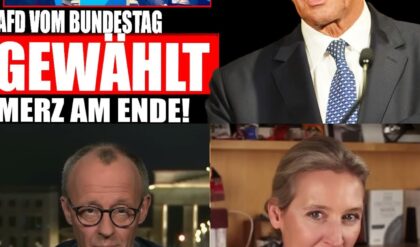Der Verrat am Verhandlungstisch: Wie Alice Weidel die West-Strategie als gescheitert erklärt und die politische Mitte Deutschlands spaltet
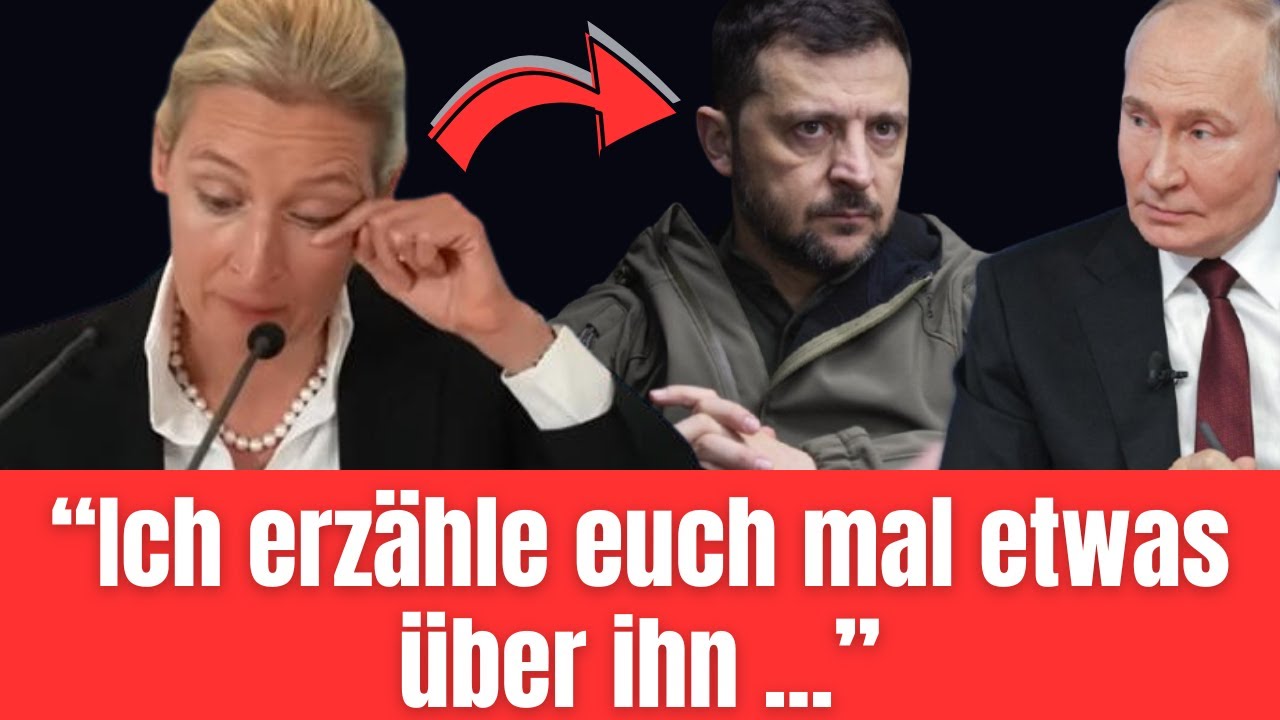
Die politische Landschaft Deutschlands ist von einem Schock erfasst, der die Außen- und Sicherheitspolitik in ihren Grundfesten erschüttert. Im Zentrum steht eine brisante Erklärung von AfD-Chefin Alice Weidel, die mit der bisherigen Linie der Bundesregierung und der etablierten Opposition radikal bricht. Mit kühler, analytischer Schärfe rechnet Weidel mit der gesamten Strategie des Westens im Ukraine-Krieg ab und liefert eine schonungslose Analyse, die den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenski als das eigentliche Opfer einer fatalen Fehleinschätzung darstellt. Ihre Aussage, dass Selenski eine „tragische Figur“ sei, wirkt wie eine politische Granate, die eine Debatte über Realismus, Moral und die diplomatische Isolation Europas auslöst.
I. Das Scheitern der Illusion: Selenski als tragische Figur
Die Kernbotschaft von Alice Weidel ist von beispielloser Klarheit: „Die Ukraine kann niemals diesen Krieg gewinnen“. Diese Erkenntnis, die von der AfD nach eigener Aussage von Beginn an geteilt wurde, entlarvt die gesamte westliche Hilfsmaschinerie als eine „völlig falsche Erwartungshaltung“ und eine gefährliche Illusion.
Der eigentliche Verrat, so Weidels These, liegt nicht in Moskau, sondern in den Hauptstädten des Westens. Man habe gegenüber Selenski eine „komplett falsche Erwartungshaltung kreiert“. Die westlichen Partner hätten den ukrainischen Präsidenten dazu gedrängt, die initialen Friedensverhandlungen von Istanbul im Jahr 2022 „über einen Haufen zu schmeißen“. Er wurde ermutigt, den Konflikt militärisch fortzusetzen.
Weidel charakterisiert Selenski als eine „tragische Figur in dem Ganzen“, weil er blindlings dem Versprechen des Westens gefolgt sei:
- Vorgeschickt und Fallen gelassen: Der ukrainische Präsident sei erst „vorgeschickt“ worden mit dem Versprechen: „Du verhandelst bitte nicht über den Frieden, wir unterstützen dich“.
- Im Regen stehen gelassen: Jetzt, da der Krieg festgefahren ist und ein „Administrationswechsel“ im Westen droht, lasse man ihn „im Regen stehen“.
Dieses „ganze Hin und Her“ ist nach Weidels Auffassung „sehr ungut“ und beweist, dass die Ukraine und ihr Präsident nur als politisches Werkzeug dienten. Die Milliardenhilfen, die Waffen und die Entsendung von Soldaten (implizit gemeint) dienten nicht dem Sieg, sondern einer verfehlten strategischen Erwartungshaltung, die zum Scheitern verurteilt war.
II. Die diplomatische Sackgasse: Das Ende der Schwarzweißmalerei
Weidel kritisiert die europäische Politik, die sich durch einen Mangel an seriöser Analyse und eine Überbetonung moralischer Kategorien auszeichnete. Sie prangert die dreijährige „Schwarzweißmalerei“ von „gut und böse“ an, die Deutschland und Europa „überhaupt gar nicht nach vorne gebracht“ habe.
Diese moralisierende Rhetorik habe Europa in eine „diplomatische Sackgasse geführt“. In dieser Sackgasse, so Weidel, seien die Europäer „gar nicht als Europäer mehr lösen können“. Das bedeutet im Klartext: Die Bundesregierung und Brüssel haben sich durch ihre kategorische Verweigerung von Gesprächen selbst jeglicher Handlungsfähigkeit beraubt.
Die einzig logische und vernünftige Lösung, die die AfD von Anfang an gefordert hatte, sei ein sofortiges Handeln gewesen: „Man hätte sich gleich an den Anfang an den Tisch setzen müssen, um seriös über den Frieden zu verhandeln“. Der Aufruf zu „Friedensverhandlung und Waffenstillstand“ ist für Weidel die einzige realistische Option. Sie betont dabei, dass die AfD den völkerrechtswidrigen Charakter des russischen Angriffs „nie in Frage gestellt“ habe – ein Versuch, die immer wieder geäußerte Kritik, die AfD sei eine Partei der „Putin Versteher“, zu entkräften. Die Partei sieht sich durch die aktuellen Entwicklungen vollständig rehabilitiert und als die einzige Kraft der Vernunft in der deutschen Politik bestätigt.
III. Die Trump-Lösung: Geopolitisches Power-Play ersetzt europäische Diplomatie

Weidels Analyse führt zu einer fundamentalen Schlussfolgerung: Weil Europa unfähig zur Selbstkorrektur und zur Überwindung seiner moralischen „Sackgasse“ ist, muss die Lösung nun von außen kommen – in Form eines transatlantischen Power-Plays durch Donald Trump.
Sie konstatiert, dass Trump nun das tut, was die Europäer nicht wagten: Er löst den Konflikt „mit dem [am] Tisch“. Diese diplomatische Initiative geht jedoch einher mit einer „brutalen“ globalen Agenda, die Weidel offenlegt und die weit über den Ukraine-Krieg hinausgeht.
Weidel zeichnet ein Bild, in dem Trump nicht nur den Frieden verhandelt, sondern auch seine eigenen geopolitischen Interessen rücksichtslos durchsetzt. Sie zitiert ihn (implizit bezugnehmend auf eine München-Rede oder ähnliches) mit einem beunruhigenden Ultimatum:
- Rohstoff-Diktat: „Entweder [ihr] gebt uns die seltenen Erden, oder ansonsten keine Hilfe mehr“.
- Technologie-Ultimatum: „Ihr hört auf, unsere großen Technologiekonzerne zu reglementieren… Ihr hört auf mit eurem EU-Wahnsinn, Kontrolle, Fake News und so weiter“.
Weidel sieht hier eine direkte Verbindung zu ihrer innerdeutschen Kritik an den „eingeschränkte[n] Meinungskorridore[n]“ und der Zensur. Sie impliziert, dass die EU und die deutsche Regierung die Wahrheit unterdrücken, während Trump droht, die deutsche Gesellschaft zu „destabilisieren“, sollten seine Forderungen nicht erfüllt werden.
IV. Die AfD als Alternative: Wahrheit statt Zensur
Die AfD nutzt diese Analyse, um sich als die einzige politische Kraft zu präsentieren, die in der Lage ist, die Realitäten der neuen geopolitischen Ordnung anzuerkennen. Sie versteht die Sprache der Macht und lehnt die „Schwarzweißmalerei“ der etablierten Parteien ab, die das Land in eine diplomatische und wirtschaftliche Abhängigkeit geführt habe.
Weidels Statement ist eine klare Kampfansage an das gesamte politische Establishment. Während die AfD immer wieder zu Unrecht unterstellt werde, der Aggressor im Ukraine-Krieg zu sein, sei sie in Wahrheit die Partei der Vernunft und des diplomatischen Realismus. Die fortwährende „Schwarzweißmalerei“ und das Ausgrenzen von Meinungen in den „eingeschränkten Meinungskorridoren“ hätten die ehrliche Problemlösung in Deutschland verhindert.
Die Weidel-Analyse ist daher eine Aufforderung zur politischen Wende: Die deutsche Außenpolitik müsse die Augen vor den Fakten öffnen und akzeptieren, dass die militärische Unterstützung keine Option mehr sei. Die Konzentration müsse auf einer sauberen, analytischen Lösung liegen.
Schlussbetrachtung: Deutschland am Scheideweg der Diplomatie

Die Aussage von Alice Weidel, dass Selenski eine „tragische Figur“ sei, ist weit mehr als eine kontroverse Schlagzeile. Sie signalisiert den tiefen Bruch mit dem deutschen Nachkriegskonsens, der stets auf Moral vor Realpolitik setzte. Weidels Interpretation, dass die Ukraine militärisch aufgerüstet wurde, nur um dann aus opportunistischen Gründen fallengelassen zu werden, stellt die gesamte Glaubwürdigkeit der westlichen Allianz in Frage.
Angesichts der offenen Thematisierung einer „diplomatischen Sackgasse“ und der mangelnden Lösungskompetenz der Europäer wird die AfD ihre Position als einzige realpolitische Kraft im Bundestag weiter ausbauen. Die Partei sieht sich als legitime Ansprechpartnerin für die neue Trump-Administration und diejenige, die die deutsche Souveränität in einer Welt brutaler Machtspiele wiederherstellen kann.
Für die deutsche Politik bedeutet dies eine existenzielle Entscheidung: Entweder hält sie weiterhin an einer moralisch gefärbten, aber militärisch und diplomatisch gescheiterten Strategie fest, was zur weiteren Isolation des Landes führen könnte. Oder sie muss sich notgedrungen den Realitäten stellen, die von der AfD und ihren transatlantischen Verbündeten aufgezeigt werden – ein Szenario, das die politische Mitte in Deutschland dauerhaft destabilisieren würde. Der Konflikt um die Ukraine ist zu einem Konflikt um die deutsche Identität in der Welt geworden, und Alice Weidel hat die schärfste Spitze der Lanze in die Wunde gestoßen. Die nächsten Schritte der Bundesregierung werden zeigen, ob sie bereit ist, die Realität anzuerkennen oder ob sie weiterhin den tragischen Helden spielen wird, der bereits verloren hat.