Sie ist eine Ikone. Eine der letzten großen Diven des deutschen Schlagers. Seit über 70 Jahren steht Mary Roos, heute 76, auf der Bühne. Mit ihrer klaren Stimme und ihrem warmen Lächeln hat sie Generationen durch Liebeskummer und Freudentänze begleitet. Sie ist die Frau aus Bingen am Rhein, die mit Liedern wie „Er gehört zu mir“ und „Aufrecht geh’n“ zu einer festen Größe der Nation wurde. Doch hinter dieser glänzenden, unangreifbaren Fassade der Bühnenpräsenz verbirgt sich ein Schatten, ein Trauma, das sie jahrzehntelang meisterhaft verbarg.
Jetzt, im Herbst ihres Lebens, bricht das Schweigen. In einer seltenen Offenbarung gesteht die Sängerin eine Emotion, die so gar nicht zu ihrem öffentlichen Bild passen will: ein tiefer, unversöhnlicher Hass. Ein Hass, der sich gegen einen einzigen Mann richtet. Einen Mann, den sie, so die schockierende Erkenntnis, „tiefer hasst als jeden anderen“ in ihrem ereignisreichen Leben.
Wer ist dieser Mann? Und was konnte er getan haben, um die Seele dieser Frau so nachhaltig zu verletzen? Die Antwort führt uns in ein Labyrinth aus Triumph und Schmerz, in eine der erfolgreichsten und zugleich tragischsten Partnerschaften der deutschen Musikgeschichte.
Die Geschichte beginnt idyllisch in Bingen am Rhein. Geboren am 9. Januar 1949 als Rosemary Böhm, wächst sie in einer Welt auf, die noch von den Echos des Krieges und dem Duft von reifen Trauben geprägt ist. Ihr Vater ist ein unermüdlicher Arbeiter, die Mutter hält die Familie zusammen. Die kleine Rosemary entdeckt ihre Liebe zur Musik durch das alte Schellackplatten-Radio. Sie singt im Kirchenchor, die Nonnen erkennen ihr außergewöhnliches Talent. Doch es ist nicht nur die Disziplin der Kirche, die sie formt, sondern auch die Lebensfreude der rheinischen Straßenfeste.
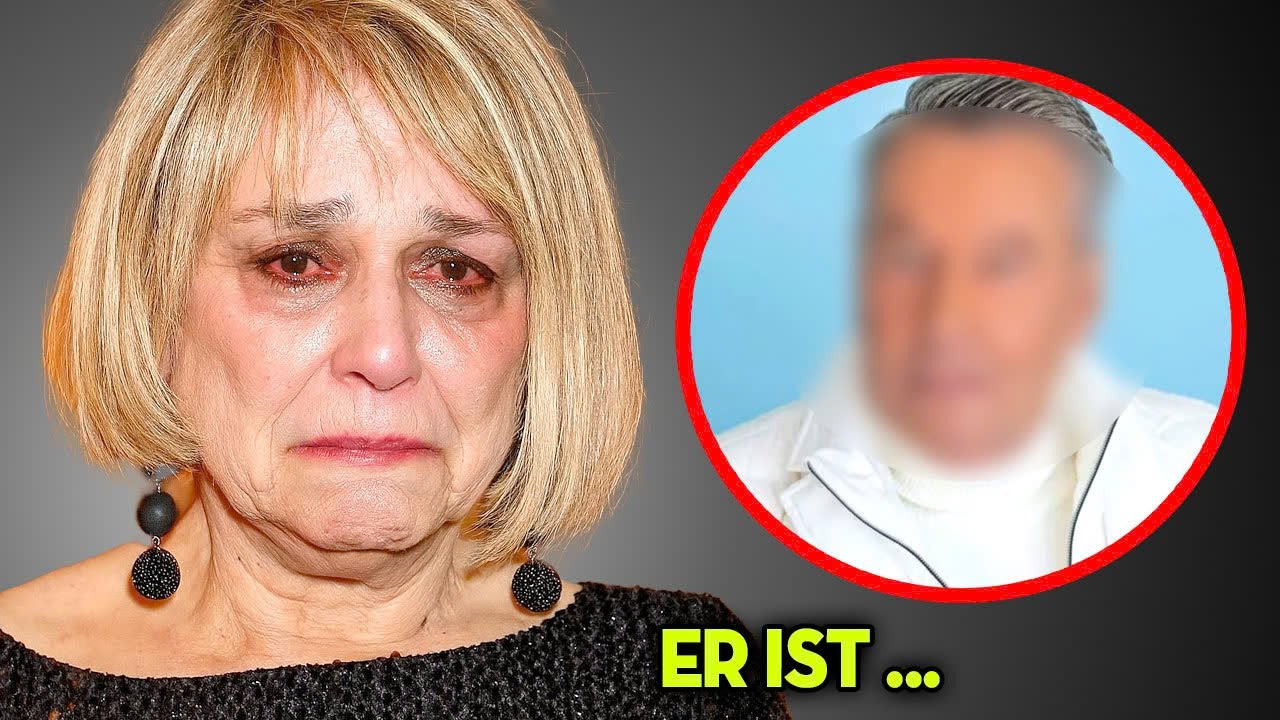
Mit 17 Jahren ist Bingen zu klein. Rosemary verlässt die Provinz und sucht ihr Glück in der pulsierenden Metropole Frankfurt. Dort, in den Studios der aufstrebenden Schallplattenfirmen, wird sie zu „Mary Rose“. Ihr erster Plattenvertrag ist kein Zufall; ein Talentscout hat sie entdeckt. Ihr Debütalbum „Er gehört zu mir“ schlägt 1967 ein. Die Texte sind einfach, poetisch und treffen den Nerv einer Generation.
Mary lernt schnell. Die Musikindustrie der 60er und 70er Jahre ist eine von Männern dominierte Welt. Produzenten diktieren, Künstlerinnen gelten oft als austauschbar. Mary lernt zu verhandeln, ihre Stimme nicht nur als Ware, sondern als Waffe einzusetzen. Sie ist erfolgreich, unabhängig und fest entschlossen, die Kontrolle niemals abzugeben. Doch dann, in den 70er Jahren, tritt der Mann in ihr Leben, der alles verändern sollte.
Sein Name: Frank Dostal.
Auf einer Gala in München begegnen sie sich. Er ist ein charismatischer, hochintelligenter Produzent, der bereits für Stars wie Heino gearbeitet hat und ein untrügliches Gespür für Hits besitzt. Ihre erste Unterhaltung über Musik dauert bis in die Morgenstunden. Sie teilen Visionen, sie spüren eine kreative und persönliche Seelenverwandtschaft. Aus Zusammenarbeit wird Romantik. 1970 heiraten sie, fernab der Presse, in einer intimen Zeremonie.
Was folgt, ist der Stoff, aus dem Legenden sind. Die Ehe beginnt idyllisch. Sie arbeiten symbiotisch. Frank managt ihre Karriere, während Marys Stimme zu neuen Höhen aufsteigt. 1971 wird ihr Sohn Julien geboren. Sie sind das Traumpaar des deutschen Showbusiness, posieren für Magazine, verkörpern das perfekte Glück.
Der absolute Triumph gelingt 1977. Mary Roos gewinnt mit dem von Frank Dostal produzierten Titel „Autobahn“ den Eurovision Song Contest (ESC) in Brighton. Es ist ein Meilenstein. Frank orchestriert den Erfolg meisterhaft. Er bucht Tourneen durch Skandinavien und Italien, wo Mary in ausverkauften Stadien gefeiert wird. Sie ziehen in ein prachtvolles Haus am Starnberger See. Sie sind auf dem Gipfel der Welt.
Doch dieser Gipfel ist ein „goldener Käfig“, und Frank Dostal hält den Schlüssel.
Was die Öffentlichkeit als perfekte Partnerschaft sieht, ist hinter den Kulissen längst zu einer Dynamik der totalen Kontrolle verkommen. Franks Ambitionen wachsen exponentiell. Er übernimmt die volle Entscheidungsgewalt. Er entscheidet über Songauswahlen, die Marys Intuition widersprechen. Er kritisiert ihre Outfits, drängt sie zu populäreren, seichteren Texten und ignoriert vehement ihre Wünsche nach künstlerischen Experimenten.
Mary, die einst nach Frankfurt zog, um die Kontrolle nie abzugeben, ist nun gefangen. In privaten Gesprächen mit Freunden flüstert sie den verhängnisvollen Satz: „Er liebt mich, doch er liebt den Erfolg mehr.“
Die Ehe, die einst eine Symbiose war, erstickt ihre Kreativität. Ihre Texte werden melancholischer, handeln von unvollständiger Liebe – die Fans lesen sie als Autobiografie und ahnen nicht, wie recht sie haben. In ihr privates Tagebuch schreibt Mary Roos den herzzerreißenden Satz: „Seine Liebe ist ein Käfig aus Gold.“

Die 80er Jahre bringen den Bruch. Die Musikwelt ändert sich, Synthesizer kommen auf. Mary will sich weiterentwickeln, doch Frank klammert sich an bewährte Formeln. Die Arbeit am Album „Bis ans Ende der Welt“ (1982) wird zur Qual. Sie streiten nächtelang in verrauchten Studios. Ihre Stimme bricht, nicht nur vor Erschöpfung, sondern vor unterdrückter Wut.
Der Konflikt frisst sich in die Familie. Ihr Sohn Julien, inzwischen ein Teenager, leidet sichtlich unter der eisigen Spannung und flüchtet sich in seine eigene Musik. Die Auseinandersetzungen eskalieren. Nach einem Konzert in Berlin, bei dem der Applaus verhalten war, konfrontiert sie ihn. Der Vorwurf, der alles zusammenfasst: „Du formst mich zu deiner Puppe!“
Es geht nicht mehr nur um Kunst, es geht auch ums Geld. Frank, als ihr Manager, behält Provisionen ein, die Mary als unfair empfindet. Sie beginnt heimlich, Anwälte zu konsultieren, liest Verträge bis in die Morgenstunden. Die Situation kulminiert 1986 in einem heftigen Streit, bei dem symbolträchtig Porzellan zerbricht. In diesen Nächten, so wird es beschrieben, beginnt der Hass zu keimen – genährt von Jahren der Unterdrückung, der Manipulation und dem Gefühl, die eigene Identität verloren zu haben.
1989 zieht Mary Roos die Reißleine. Die Scheidung von Frank Dostal ist ein formaler Akt in einem nüchternen Gerichtssaal, doch für sie ist es ein “Akt der Befreiung”. Es ist ein schmerzhafter, chirurgischer Schnitt. Sie verlässt das Haus am Starnberger See und zieht in eine Villa am Chiemsee – ein Ort, an dem die Vögel ihre Freiheit singen.
Die Zeit danach ist ein Kampf. Der finanzielle Bruch ist hart. Die Auseinandersetzungen um die Rechte an den gemeinsamen Hits ziehen sich hin. Doch künstlerisch erlebt sie eine Wiedergeburt. Ihr erstes Solo-Werk nach der Trennung, das Album „Frei“ (1990), ist eine einzige Katharsis. Die Texte sind roh, ehrlich und voller Schmerz. Die Fans spüren die Authentizität, weinen in ihren Konzerten.
Mary Roos erobert sich ihre Karriere zurück, diesmal allein. Sie baut ein neues Team auf. Ihr Sohn Julien, der ironischerweise Musikproduktion studiert hat – in den Fußstapfen des Vaters, aber mit der Ethik der Mutter –, steht ihr bei. Sie gründet Workshops für junge Sängerinnen, spricht über Empowerment, inspiriert von ihren eigenen traumatischen Kämpfen.
Und Frank Dostal? Der Mann, der sie zum Star machte und sie fast zerbrach? In privaten Kreisen spricht sie offen von ihrem Hass. Jede Begegnung, unvermeidlich wegen ihres Sohnes, bleibt frostig.
Heute, mit 76 Jahren, thront Mary Roos als die „Grand Dame“ des deutschen Chansons und Schlagers. Sie füllt immer noch Hallen, ihre Stimme ist gereift, trägt die Tiefe eines gelebten Lebens. Sie arbeitet eng und harmonisch mit ihrem Sohn Julien zusammen. Sie ist zurück in Bingen, wo sie Festivals ehrt. Sie scheint im Reinen mit sich zu sein.
Doch der dunkle Fleck bleibt. In einem intimen Moment fällt das finale, bittere Urteil über den Mann, den sie einst liebte und nun hasst: Frank Dostal. „Er nahm mehr als er gab.“
Der Hass, so scheint es, ist über die Jahrzehnte zu einem Schutzschild geworden. Er ist der Preis für ihre Freiheit, die ständige Mahnung, nie wieder die Kontrolle abzugeben. Es ist die Narbe einer Frau, die aus den Trümmern eines goldenen Käfigs stieg, um aufrecht gehen zu können – eine Wunde, die tief sitzt, aber die sie letztendlich zu der starken, unabhängigen Künstlerin gemacht hat, die sie heute ist.






