Sie galten als unbesiegbar. Als Titanen. Als Helden, die auf ihren Schultern die Hoffnungen einer ganzen Nation trugen. Wir sahen sie triumphieren, wir sahen sie kämpfen, und wir feierten sie als Ikonen. Ihre Namen sind in die Geschichtsbücher des deutschen Sports gemeißelt: Weltmeister, Olympiasieger, Rekordhalter. Doch abseits des grellen Rampenlichts, verborgen hinter dem Glanz der Medaillen und dem Lärm der Stadien, kämpften viele von ihnen einen zweiten, stilleren und unendlich zerstörerischen Kampf. Es ist der Kampf gegen einen Gegner, der keine Gnade kennt: den Alkohol.
Für einige begann es als harmloser Schluck zur Feier eines großen Sieges. Für andere war es ein ständiger, leiser Begleiter – ein Mittel, um den unermesslichen Druck zu betäuben, die Schmerzen von Verletzungen zu lindern oder die Leere nach persönlichen Krisen zu füllen. Doch das Endergebnis war für viele dasselbe: zerbrochene Karrieren, zerrüttete Familien und ein öffentliches Bild, das unwiderruflich beschädigt wurde.
Dies ist ein schonungsloser Blick auf 13 legendäre deutsche Sportler, deren Leben und triumphale Laufbahnen von den dunklen Schatten des Alkohols überschattet wurden. Einige fanden auf beeindruckende Weise den Weg zurück ins Leben, andere verloren im Ringen mit ihrer Sucht fast alles. Ihre Geschichten sind Mahnungen. Sie sind der erschütternde Beweis dafür, dass selbst die größten und stärksten Idole nicht unverwundbar sind.

Die verlorene Generation: Der Fall nach der Karriere
Einer der schmerzhaftesten Mythen des Sports ist der des glücklichen Helden im Ruhestand. Die Realität sieht oft anders aus. Wenn der Applaus verstummt, die Kameras sich abwenden und der strukturierte Alltag des Profisports wegbricht, öffnet sich für viele ein tiefer, dunkler Abgrund.
Niemand verkörpert diese Tragödie so sehr wie Gerd Müller. Der “Bomber der Nation”, ein Mann, der auf dem Platz wie ein eiskalter Vollstrecker wirkte, der Deutschland 1974 zum WM-Titel schoss. Doch nach dem Ende seiner Karriere in den frühen 1980er Jahren verlor dieser Gigant jeden Halt. Ohne die tägliche Routine, ohne den Adrenalinkick der Spiele, fand er einen neuen Begleiter: die Flasche. Freunde berichteten, Müller habe oft schon am Vormittag getrunken, er isolierte sich, zog sich zurück. Mitte der 80er war er körperlich ausgezehrt und mental am Boden. Es war eine Intervention seiner alten Weggefährten beim FC Bayern München, allen voran Uli Hoeneß, die ihm das Leben rettete. Sie organisierten einen Platz in einer Entzugsklinik und gaben ihm danach einen Job als Trainer im Nachwuchsbereich. Eine Rettung in letzter Sekunde für ein nationales Heiligtum, das im Ruhm zu ertrinken drohte.

Ähnlich dramatisch, aber vor den Augen einer neueren Generation, verlief der Absturz von Jan Ullrich. Der Mann aus Rostock, der 1997 als erster und einziger Deutscher die Tour de France gewann, wurde zum Symbol einer neuen Ära des deutschen Sports. Doch nach seinem Karriereende 2007, überschattet von Doping-Vorwürfen, brach seine Welt zusammen. Ohne die disziplinierende Struktur des Radsports geriet “Ulle” in eine verheerende Abwärtsspirale. Alkoholexzesse, psychische Probleme und juristische Konflikte bestimmten die Schlagzeilen. Er gab später zu, in seinen dunkelsten Phasen täglich getrunken zu haben, oft schon morgens, um mit Depressionen und der inneren Leere umzugehen. Mehrfache Entzugsklinik-Aufenthalte folgten. Der strahlende Held des Radsports war zum Gefangenen seiner Sucht geworden.
Und dann ist da Andreas Brehme. Sein Name ist für immer verbunden mit jenem einen Moment in Rom 1990, als er im WM-Finale den entscheidenden Elfmeter gegen Argentinien verwandelte und Deutschland zum Weltmeister machte. Ein Nationalheld. Doch Jahrzehnte später berichteten die Medien nicht mehr über Triumphe, sondern über Schulden, persönliche Krisen und seinen offensichtlichen Kampf mit dem Alkohol. Nach dem Karriereende fehlte der Halt. Investitionen scheiterten, Sponsoren blieben aus. Journalisten beschrieben ihn als oft angetrunken, Bilder machten die Runde. Sein Tod im Februar 2024 löste tiefe Betroffenheit aus – nicht nur um den Helden von Rom, sondern auch um den Mann, dessen späteres Leben zu einer stillen Tragödie geworden war.
Auch Ronny Weller, ein Kraftpaket und Olympiasieger im Gewichtheben, sprach offen über die Tücken des Ruhestands. Nach Verletzungen und Rückschlägen suchte er Trost im Trinken. Als die strikte Trainingsroutine wegfiel, wurde der Alkohol zu einem gefährlichen Begleiter, der seine Gesundheit zusätzlich zu den körperlichen Beschwerden des Leistungssports untergrub.
Der ständige Begleiter: Alkohol während der aktiven Zeit
Noch alarmierender sind die Geschichten jener Athleten, die den Kampf nicht erst nach der Karriere, sondern mittendrin führten – während sie auf höchstem Niveau performen mussten.
Das extremste Beispiel ist Uli Borowka. “Die Axt”, einer der härtesten Verteidiger seiner Zeit bei Werder Bremen, galt als Albtraum für Stürmer. Doch wie er später zugab, war er fast seine gesamte Profikarriere über alkoholabhängig. Borowka trank bereits vor dem Training, oft Bier, manchmal Hochprozentiges. Vor wichtigen Spielen griff er zur Flasche, um das nervöse Zittern zu stoppen. Selbst während der Meisterschaftssaison 1988 war er nie wirklich nüchtern. Die Sucht blieb lange unentdeckt, weil er auf dem Platz funktionierte. Erst nach der Karriere brach der Schutzwall, und Borowka rutschte tiefer ab. Heute ist er einer der wenigen, die den Kampf nicht nur gewonnen haben, sondern mit ihrer Geschichte offen umgehen und Suchtprävention betreiben.
Ein “stilles Problem” hatte auch Andreas Köpke. Der Held der Europameisterschaft 1996, der Inbegriff der Ruhe und Gelassenheit im Tor, suchte nach Niederlagen und während Verletzungspausen Trost im Alkohol. Ehemalige Mitspieler beschrieben, dass er bei Feiern über die Stränge schlug. Es war ein schleichendes Risiko für einen Mann, dessen Leistung von perfekter Konzentration abhing.
Selbst der elegante Mehmet Scholl, der kreative Freigeast des FC Bayern, sprach später darüber, in seiner aktiven Zeit gelegentlich zu viel getrunken zu haben. Vor allem, wenn Verletzungen ihn monatelang ausbremsten, suchte er im Alkohol ein “Stück Normalität” in einer Welt, die von Leistungsdruck geprägt war.

Kultur des Feierns: Wenn Alkohol dazugehört
Für eine andere Generation von Spielern war Alkohol kein Dämon, sondern ein fester Bestandteil der Kultur. In den 1970er und 1980er Jahren war der Konsum im Profifußball weit weniger tabuisiert.
Paul Breitner, der Rebell auf dem Platz, pflegte auch privat einen Lebensstil ohne Vorschriften. Zeitzeugen berichten von Feiern bis in die Morgenstunden, begleitet von reichlich Bier und Wein. Breitner selbst blickte später gelassen auf diese “andere Fußballkultur” zurück, in der Lebenslust oft vor Disziplin stand.
Auch Rudi Völler, die beliebte “Tante Käte”, galt als jemand, der den Feierabend gerne mit einem Glas ausklingen ließ. Fotos von “Tante Käte im Feiermodus” füllten die Boulevardblätter. Für die Fans war es ein Beweis seiner “Volksnähe”, Kritiker bemängelten jedoch die Vorbildfunktion.
Ähnlich bei Lothar Matthäus. Der Rekordnationalspieler, ein Inbegriff von Disziplin auf dem Platz, war bekannt dafür, nach harter Arbeit auch hart zu feiern. Rauschende Nächte nach Meisterschaften gehörten dazu. Matthäus selbst witzelte später, man lebe als Fußballer nicht nur von Mineralwasser.
Die “Was wäre wenn”-Karrieren
Und schließlich gibt es jene Spieler, bei denen der riskante Lebensstil eine potenziell noch größere Karriere verhindert haben könnte. Bernd Schuster, das Augsburger Genie, das bei Barcelona und Real Madrid glänzte, nutzte Alkohol als Ventil gegen den Druck. Später als Trainer wirkte er bei Pressekonferenzen fahrig, was zu Konflikten führte.
Marco Rehmer, der “stille Verteidiger” von Hertha BSC, war bekannt für “laute Nächte”. Berichte über Kneipentouren und Partys häuften sich. Kritiker sahen einen direkten Zusammenhang zu seinen Formschwankungen.
Noch deutlicher war es bei Frank Ordenewitz, Spitzname “Ordinho”. Der gefürchtete Stürmer von Werder Bremen investierte in manchen Phasen mehr Energie ins Nachtleben als ins Training. Sein Name wird bis heute mit einem Lebensstil verbunden, der ihn sportlich um noch größere Erfolge gebracht haben könnte.
Das gebrochene Tabu
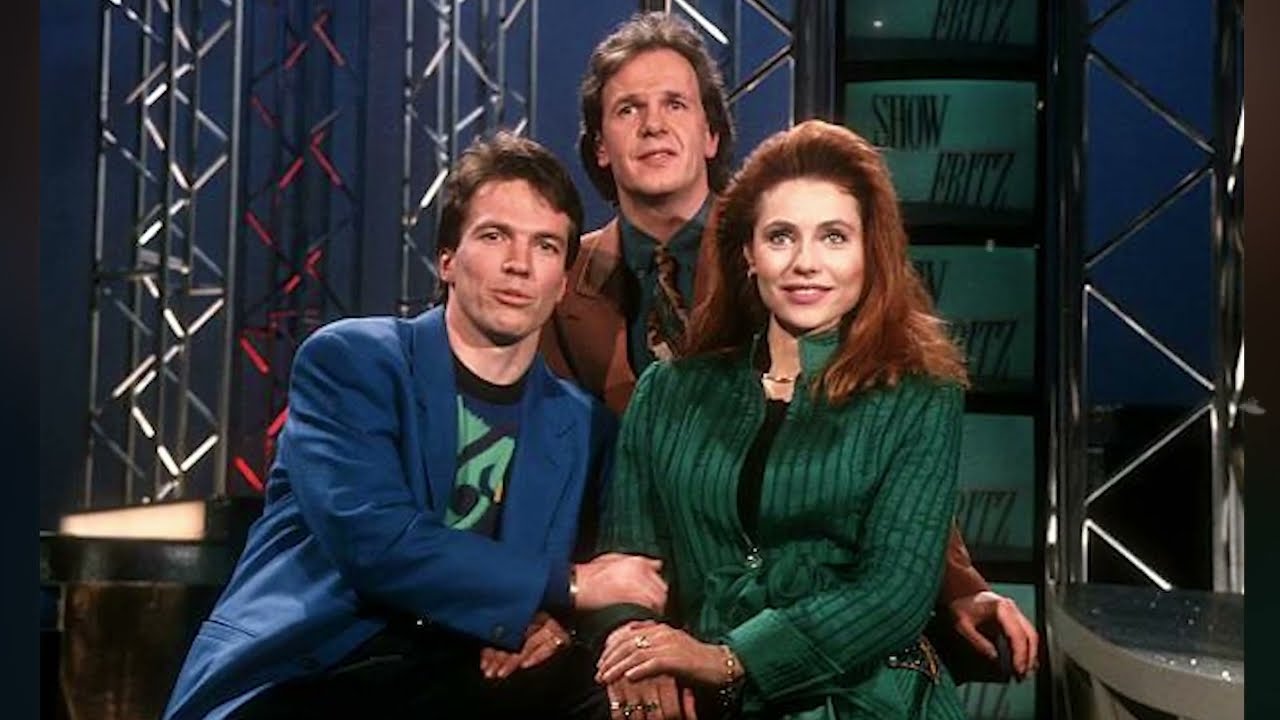
Die Geschichten dieser 13 Männer sind so unterschiedlich wie ihre Karrieren. Sie reichen von Weltmeistern, die nach der Karriere fielen, bis zu jenen, die ihre Sucht mitten im größten Erfolg verbargen. Sie erzählen von einer Kultur, die das Trinken verharmloste, und von dem unermesslichen Druck, der auf den Schultern von Idolen lastet.
Einige, wie Uli Borowka, haben den Weg zurück gefunden und nutzen ihre Erfahrung, um anderen zu helfen. Andere, wie Andreas Brehme oder Gerd Müller, haben ihre Kämpfe mit ins Grab genommen. Was all diese Schicksale eint, ist die schmerzhafte Erkenntnis, dass hinter den glänzenden Pokalen und den unvergesslichen Triumphen Menschen stehen. Menschen, die nicht unverwundbar sind.
Ihre Geschichten erinnern uns daran, dass der wahre Sieg manchmal nicht auf dem Spielfeld errungen wird, sondern im stillen, täglichen Kampf gegen die eigenen Dämonen.





