Die Einführung des Bürgergelds durch die amtierende Ampelkoalition sollte ursprünglich eine Zeitenwende in der deutschen Sozialpolitik markieren: Weg von der stigmatisierenden „Hartz IV“-Ära, hin zu mehr Vertrauen, Qualifizierung und einer besseren sozialen Absicherung. Doch die Realität, so legte es der renommierte Freiburger Ökonom und Finanzwissenschaftler Berthold Raffelhüschen in seiner scharfen Analyse im WELT Talk dar, entpuppt sich als ein finanzpolitisches Desaster mit verheerenden Langzeitfolgen. Raffelhüschen, bekannt für seine nüchternen und schonungslosen Berechnungen der intergenerativen Gerechtigkeit, diagnostizierte in der neuen Sozialleistung nicht nur einen finanziellen Sprengsatz, sondern bezeichnete das Bürgergeld unverblümt als ein „leistungsloses Grundeinkommen“, das die fundamentalen Anreize des Arbeitsmarktes und damit die Funktionsfähigkeit des gesamten Sozialstaates massiv untergrabe.
Die „heftige Schelte“, die Raffelhüschen für die Ampel bereithielt, war eine umfassende Abrechnung mit einer Politik, die er als kurzsichtig, von Ideologie getrieben und zutiefst unfair gegenüber der arbeitenden Bevölkerung und nachfolgenden Generationen ansieht. Seine Kritik konzentrierte sich auf zwei zentrale Pfeiler: Die Zerstörung des Lohnabstandes und die unverantwortliche Kostenexplosion in Zeiten ohnehin angespannter Staatsfinanzen.
Der Tod des Arbeitsanreizes: Das Lohnabstandsproblem als systemisches Versagen
Der Kern der Raffelhüschen’schen Kritik ist eine ökonomische Grundwahrheit: Arbeit muss sich lohnen. Das Bürgergeld, insbesondere nach seiner drastischen Erhöhung und den gelockerten Sanktionsmechanismen, habe diesen fundamentalen Lohnabstand zwischen der Aufnahme einer Tätigkeit im Niedriglohnsektor und dem bloßen Bezug staatlicher Transferleistungen de facto ausgelöscht.
Der Ökonom rechnete präzise vor, wie die Summe aus Regelsatz, Kosten der Unterkunft und den zahlreichen Freibeträgen für Hinzuverdienste dazu führe, dass eine alleinstehende Person ohne Kinder, die keiner Arbeit nachgeht, kaum schlechter dastehe als ein Geringverdiener, der 40 Stunden die Woche schuften muss. Für viele potenzielle Arbeitnehmer im unteren Lohnsegment stellt sich damit eine rein rationale Frage: Warum die Mühe der Arbeit, wenn der Netto-Gewinn nur marginal über dem des Bürgergeldempfängers liegt? Die Antwort, so Raffelhüschen, sei eine bittere Wahrheit für die deutsche Wirtschaft: Der Arbeitsanreiz sei systematisch ausgehöhlt.
Er betonte, dass die Ampel-Koalition – insbesondere die Teile, die auf eine Reduzierung des Drucks auf die Empfänger drängten – damit das Prinzip der Gegenseitigkeit (Fördern und Fordern) geopfert habe. Das Argument, man wolle die Menschen durch Qualifizierung besser in Arbeit bringen, verkenne die ökonomische Realität: Solange die finanzielle Notwendigkeit fehle, blieben die Anreize zur Qualifikation und zur Jobsuche gering. Die de facto „Schonzeit“ für Bürgergeldempfänger, in der Vermögen und Angemessenheit der Wohnung kaum geprüft werden, verstärke diesen Effekt. Raffelhüschen sah darin einen „ordnungspolitischen Irrweg“, der nicht nur die Leistungsempfänger in der Abhängigkeit halte, sondern vor allem die Ehrlichkeit und Anstrengung der arbeitenden Bevölkerung mit Füßen trete.
Diese Lohnabstands-Problematik treffe direkt den Niedriglohnsektor, der ohnehin von Arbeitskräftemangel betroffen sei. Wo Arbeitgeber händeringend Personal suchen, sorgt das Bürgergeld dafür, dass ein staatlich finanzierter Wettbewerb um die Faulheit entsteht, in dem der Staat den Arbeitgebern die Arbeitskräfte abgräbt.
Die Kosten-Zeitbombe: Eine Generationenlast ohne Gleichen
Neben der Zerstörung der Arbeitsanreize fokussierte Raffelhüschen seine „Schelte“ auf die finanzielle Unverantwortlichkeit der Ampel. Er erinnerte die Zuschauer daran, dass die Sozialausgaben in Deutschland bereits vor der Bürgergeldreform auf Rekordniveau lagen. Die automatische, überdurchschnittliche Erhöhung des Bürgergelds, die fast einer Inflationsanpassung der Transferleistungen gleichkomme – und damit höher ausfalle als die Lohnsteigerungen vieler Arbeitnehmer – sei ein „Brandbeschleuniger“ für die Staatsverschuldung.
Raffelhüschen warnte nachdrücklich davor, die steigenden Sozialkosten als reine Ausgabenposten zu sehen. Sie seien vielmehr eine immense intergenerative Last. In seiner Rolle als Experte für Nachhaltigkeit in den Sozialsystemen wies er darauf hin, dass die aktuellen Mehrausgaben nicht von den aktuellen Empfängern selbst finanziert würden, sondern über Schulden und zukünftige Abgaben von der jüngeren und nachfolgenden Generation. Er forderte deshalb, den starken Anstieg des Bürgergelds „drosseln“ zu müssen, um die öffentlichen Kassen zu entlasten.
Die Ampelkoalition habe laut Raffelhüschen jegliches Gefühl für die finanzielle Realität verloren. Er kritisierte die simultane Verabschiedung teurer sozialpolitischer Gesetze (Bürgergeld, Rentenpaket, Kindergrundsicherung) ohne eine tragfähige Gegenfinanzierung. Diese Politik sei ein Akt der Ungerechtigkeit gegenüber der Jugend, die in Kauf genommen werde, um kurzfristige Wählerstimmen bei der älteren Generation und den Transferleistungsempfängern zu gewinnen. Das Bürgergeld sei, so Raffelhüschen, das Sinnbild dieser Kurzsichtigkeit; eine Investition in die soziale Ruhe, die langfristig das ökonomische Fundament des Landes untergrabe.
Die Kosten-Lüge, so seine Implikation, liege darin, dass die Regierung die langfristigen Effekte auf den Arbeitsmarkt und die Staatsverschuldung systematisch ignoriere. Jede Person, die sich aufgrund des fehlenden Lohnabstands gegen die Arbeitsaufnahme entscheide, koste den Staat nicht nur die ausgezahlte Leistung, sondern auch die entgangenen Einnahmen aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Ein doppelter Schaden, der sich exponentiell verstärke.
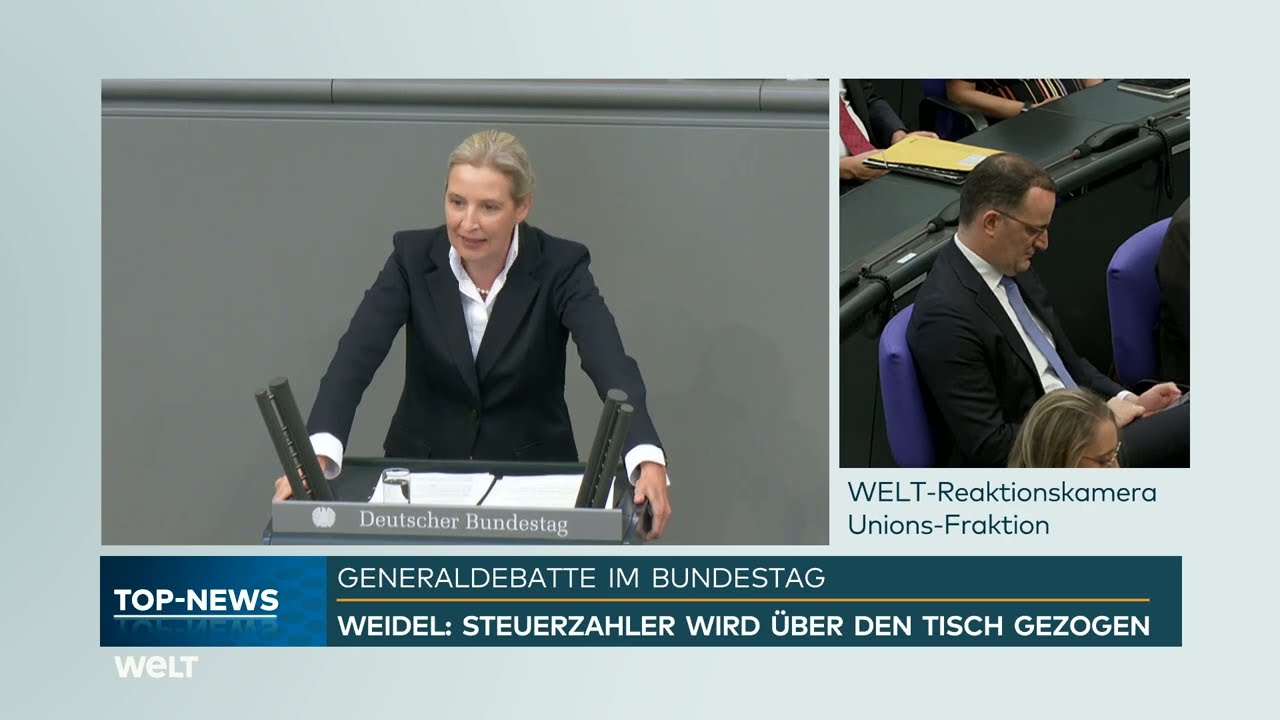
Die Zerlegung der „Ampel“: Ideologie statt Ökonomie
Raffelhüschens Kritik beschränkte sich nicht nur auf die reine Bürgergeld-Systematik, sondern galt der gesamten finanz- und sozialpolitischen Ausrichtung der Ampelkoalition. Er sah in der Koalition aus SPD, Grünen und FDP eine gefährliche Mischung, in der die sozialpolitische Großzügigkeit der SPD und der Grünen – die er ideologisch befangen nannte – die notwendige finanzpolitische Vernunft der FDP systematisch aushebele.
Die FDP, die sich traditionell als Partei der Haushaltsdisziplin verstehe, habe in der entscheidenden Phase der Bürgergeld-Debatte kapituliert. Raffelhüschen unterstellte der FDP, ihre marktwirtschaftlichen Prinzipien dem Machterhalt geopfert zu haben. Das Resultat sei ein fauler Kompromiss, der die schlimmsten Elemente der Sozialpolitik – hohe Transfers ohne ausreichende Gegenleistung – mit der Illusion von Qualifizierung verknüpfe, ohne die notwendigen Sanktionen durchzusetzen.
Der Ökonom geißelte insbesondere die Entkopplung der sozialen Transfers von der realen wirtschaftlichen Leistung. Während die deutsche Wirtschaft unter hohen Energiepreisen, Bürokratie und mangelnden Investitionen leide, zementiere die Ampel ein Sozialsystem, das die Leistungsträger bestrafe. Er sprach von einer „geballten Inkompetenz und Ineffizienz“ der Regierung, wenn es darum gehe, langfristige finanzielle Stabilität zu gewährleisten.
Raffelhüschen forderte von der Ampel einen sofortigen Kurswechsel und weitergehende Vorschläge:
- Drastische Kürzung der geplanten Erhöhungen: Der Anstieg des Bürgergelds müsse verlangsamt oder gestoppt werden, um den Lohnabstand wiederherzustellen.
- Verschärfung der Sanktionen: Das Prinzip des „Forderns“ müsse durch eine klare Regelung gestärkt werden, die Arbeitsangebote konsequent sanktioniert.
- Fokus auf echte Aktivierung: Statt reiner Qualifizierung müsse die Politik auf die schnelle Integration in den Arbeitsmarkt setzen, auch in einfache Tätigkeiten, um die Menschen aus der Abhängigkeit zu führen.
Fazit: Der Notruf aus der Ökonomie
Berthold Raffelhüschens Auftritt im WELT Talk war mehr als eine „Schelte“; es war ein Notruf aus der Wissenschaft an die politische Vernunft. Er malte das düstere Bild eines Sozialstaates, der sich selbst aushöhlt, indem er die Motivation zur Arbeit zerstört und die Last der Finanzierung auf eine immer kleiner werdende Gruppe von Leistungsträgern und zukünftigen Generationen abwälzt.
Das Bürgergeld, so seine abschließende Bilanz, sei in seiner aktuellen Form nicht nur unfair und unbezahlbar, sondern in seiner Wirkung subversiv für die gesamte Wirtschaftsordnung. Die Ampelkoalition habe mit dieser Reform nicht den Sozialstaat gerechter, sondern ihn zur tickenden Zeitbombe gemacht. Die Konsequenzen dieses „leistungslosen Grundeinkommens“ würden sich nicht sofort in den Statistiken, aber unweigerlich in der sinkenden Arbeitsmoral, der steigenden Staatsverschuldung und der wachsenden Frustration der hart arbeitenden Bevölkerung bemerkbar machen. Raffelhüschens Forderung ist klar: Deutschland braucht eine Rückbesinnung auf die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, in der Leistung belohnt und Eigenverantwortung gefördert wird – und keine weitere Ausweitung von Transferleistungen, die den Weg in die soziale Abhängigkeit zementieren. Der Ball liegt nun im Feld der Politik, um diese ökonomische Realität anzuerkennen und den gefährlichen Kurs zu korrigieren.






