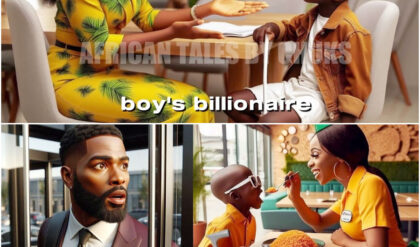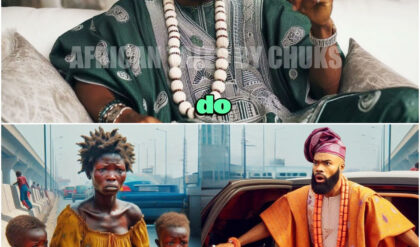Sie war Deutschlands erster großer Kinderstar, das Gesicht des Wirtschaftswunders, eine Ikone, die Generationen mit Unschuld und Lebensfreude verzauberte. Cornelia „Conny“ Froboess. Ihre Ehe mit dem Star-Regisseur Helmut Matthiasek, die über sechs Jahrzehnte hielt, galt als eine der stabilsten und beneidenswertesten Verbindungen der deutschen Kulturszene. Ein Fels in der Brandung in einer flüchtigen Welt.
Zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes bricht die heute 82-jährige Schauspielerin dieses Bild. In einer autorisierten Biografie gewährt sie Einblicke, die so tief und schmerzhaft sind, dass sie die glänzende Fassade von 60 Jahren zertrümmern. Sie spricht von Phasen der Entfremdung, von Verzweiflung, von Isolation und Momenten, in denen sie an Trennung dachte. Sie spricht von der „Hölle“.
Es ist ein Geständnis, das schockiert, aber vor allem eines ist: zutiefst menschlich. Es ist die Geschichte einer Frau, die früh lernte, unter Druck zu funktionieren, und diese Resilienz brauchte, um nicht nur eine beispiellose Karriere, sondern auch eine Ehe zu überstehen, die alles andere als ein Märchen war.

Um die Tiefe dieses Geständnisses zu verstehen, muss man zurückblicken auf das Fundament, auf dem dieses Leben gebaut wurde. Geboren 1943 in Wriezen, wohin ihre Mutter vor den Bombenangriffen auf Berlin geflohen war, wuchs die junge Cornelia in den Trümmern der Nachkriegszeit im Berliner Bezirk Wedding auf. Inmitten von Chaos und Not, geprägt vom Ehrgeiz ihres Vaters, einem Komponisten, entdeckte sie die Bühne. 1951, mit gerade einmal sieben Jahren, sang sie „Pack die Badehose ein“ und wurde über Nacht zu „der kleinen Cornelia“. Sie war das Symbol des Wiederaufbaus, ein unbeschwertes Lachen in einer traumatisierten Nation.
Doch hinter der Bühne, so enthüllt die Biografie, lernte das Kind bereits früh Verantwortung und eiserne Disziplin. Während andere spielten, nahm sie Gesangs- und Tanzunterricht. Als Teenager vollzog sie den Wandel zum Rock-and-Roll-Idol, sang „Diana“ und „I Love You Baby“ und wurde zur Projektionsfläche einer Jugend, die sich zwischen Unschuld und Rebellion bewegte. Sie lernte, unter Druck zu performen, eine Fähigkeit, die ihr späteres Leben definieren sollte.
Ihre Karriere war ein Mosaik des Erfolgs. Duette mit Peter Kraus, Blockbuster-Filme wie „Connie und Peter machen Musik“ (1960) und der unvergessene Auftritt beim Grand Prix Eurovision 1962 mit „Zwei kleine Italiener“. Sie war auf dem Gipfel. Doch Conny Froboess wollte mehr. Sie suchte die Tiefe, die der Schlager ihr nicht bieten konnte. Mitte der 1960er Jahre traf sie eine radikale Entscheidung: den Abschied von der Popmusik.
Sie wandte sich dem Theater zu, einem Ort der Ernsthaftigkeit. Und dort, in der Kulturszene der späten 60er, traf sie den Mann, der ihr Leben prägen sollte: Helmut Matthiasek. Er, der renommierte, intellektuelle Theaterregisseur und Intendant, war älter, bereits zweimal geschieden, und strahlte eine Stabilität und intellektuelle Tiefe aus, die sie faszinierte. Er sah in ihr nicht den Popstar „Connie“, sondern die Künstlerin Cornelia. Sie heirateten am 3. August 1967. Es war der Beginn einer Verbindung, die 55 Jahre, bis zu seinem Tod, halten sollte.
Die ersten Jahre schienen das Ideal einer Künstlerehe zu verkörpern. Sie zogen ins malerische Inntal, eine „Oase der Ruhe“ nahe dem Wendelstein. Später, als Matthiasek die Leitung des Gärtnerplatztheaters in München übernahm, begann ihre beeindruckende zweite Karriere. Ab 1972 wurde sie Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele, brillierte in Klassikern und wurde von Kritikern für ihre Wandlungsfähigkeit gefeiert.

Das private Glück schien vollkommen. 1968 kam Tochter Agnes zur Welt, 1970 Sohn Kaspar. Conny Froboess, die Ikone, jonglierte nun zwischen Windeln, schlaflosen Nächten und anspruchsvollen Theaterproben. Sie etablierten Rituale: wöchentliche Spaziergänge in den Bergen für offene Gespräche, Familienabende, an denen Musik gemacht wurde. Es war das Bild einer perfekten, harmonischen Familie, die Kunst und Leben meisterte.
Doch bereits in den 1970er Jahren zeigten sich die ersten Risse in der Idylle. Die „Hölle“, von der Froboess spricht, schlich sich langsam ein. Beide Partner standen unter enormem beruflichem Druck. Sie verbrachte lange Abende und Nächte bei intensiven Proben an den Kammerspielen. Er kämpfte als Intendant mit administrativen Problemen und Budgetkürzungen, was zu Frustration führte.
Die Familie litt unter den unregelmäßigen Zeitplänen. Geplante Erholungswochenenden wurden ständig von Notfällen durchkreuzt. Hinzu kamen gesundheitliche Probleme bei Conny Froboess: Erschöpfungssymptome, bedingt durch den ständigen Spagat zwischen Bühne und Zuhause.
In den 1980er Jahren eskalierten die Konflikte. Während sie auf der Bühne Erfolge feierte, kam es zu Hause zu heftigen Auseinandersetzungen. Ein zentraler Reibungspunkt war die Erziehung der Kinder, die nun im Teenageralter waren. Ihre direkte, emotionale Art prallte auf seinen strengen Perfektionismus, den er aus seiner österreichischen Herkunft mitbrachte. Die Biografie beschreibt Phasen der Entfremdung. Die Kommunikation brach zeitweise ab. Missverständnisse häuften sich und vergifteten die Atmosphäre.
Die Dynamik verschob sich dramatisch, als Matthiasek 1992 in den Ruhestand ging. Er fühlte sich untätig, suchte nach neuen Projekten, während ihre Karriere im Fernsehen, etwa mit „Praxis Bülowbogen“, einen neuen Höhepunkt erreichte. Hinzu kam die emotionale Last der Pflege ihrer eigenen alternden Eltern, die koordiniert werden musste.
In diesen „Sturmperioden“, wie Froboess sie nennt, kamen die Zweifel. Die Ehe stand mehr als einmal auf der Kippe. Doch die tiefsten Täler, der Kern dessen, was sie als „Hölle“ beschreibt, begannen in den 2010er Jahren. Helmut Matthiaseks Gesundheit nahm dramatisch ab. Conny Froboess wurde von der gefeierten Schauspielerin zur Hauptpflegerin.

Sie übernahm alles. Sie fütterte ihn, sie pflegte ihn, sie organisierte den Alltag auf ihrem gemeinsamen Bauernhof in Raubling. Diese Rolle, so gibt sie zu, brachte sie an den Rand der emotionalen Erschöpfung. Es gab Momente der tiefsten Verzweiflung, in denen sie Gedanken an eine Trennung (Trennungsgedanken) nicht mehr verdrängen konnte. Die „Hölle“ manifestierte sich in einem Gefühl der totalen Isolation, in anhaltenden Konflikten, die aus der Überlastung entstanden, und dem ständigen Bewusstsein des nahenden Verlusts.
Wie überlebt eine Liebe 60 Jahre voller derartiger Krisen? Die Antwort, die Conny Froboess gibt, ist so schmerzhaft wie tröstlich: durch Arbeit. Und durch Vergebung.
Sie suchten professionelle Hilfe, machten Therapien. Sie lernten, Konflikte durch strukturierte Gespräche zu lösen. Das zentrale Element, das ihre Ehe rettete, war „Vergebung“. Das Loslassen von altem Groll, das bewusste Zuhören, ohne sofort zu urteilen. Es waren diese kleinen Gesten, ein handgeschriebener Brief, ein spontaner Ausflug, ein gemeinsames Lachen über alte Zeiten, die die Brücken wieder aufbauten, die zuvor eingestürzt waren.
Als Helmut Matthiasek am 7. April 2022 starb, war es ein würdiger Tod, umgeben von seiner Familie. Das Ende einer Ära. Conny Froboess beschreibt diesen Weg als einen gemeinsamen Gang „durch die Hölle“. Ein Weg, der sie aber auch unzertrennlich machte.
Heute reflektiert die 82-Jährige mit einer beeindruckenden Klarheit über diese Zeit. Sie demontiert das Ideal der perfekten Ehe. Glück, so ihre Lektion, ist nicht konstant. Es kommt in Wellen, unterbrochen von tiefen Tälern, die eine Bindung entweder zerstören oder unzerstörbar machen. Vergebung, sagt sie, sei der „Kleber“, der die Risse kitten kann.
Trotz der Hölle, trotz der Stürme, hält sie an einem Satz fest, der die Komplexität ihrer 60-jährigen Liebe zusammenfasst: „Wir haben mehr gelacht als geweint.“
Conny Froboess hat der Öffentlichkeit nie nur die leichte Muse geboten. Sie wechselte ins ernste Fach, als es niemand erwartete. Nun, zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes, tut sie es wieder. Sie bricht mit dem Tabu, dass eine lange Ehe automatisch eine glückliche sein muss. Sie zeigt, dass wahre Partnerschaft nicht in ewiger Harmonie liegt, sondern in der Fähigkeit, gemeinsam zu leiden, sich zu vergeben und dennoch, oder gerade deswegen, zu wachsen. Auch wenn sie sich manchmal einsam fühlt, sagt sie, sei ihr Mann geistig immer noch für sie „ansprechbar“.
Ihre Geschichte ist kein Märchen. Es ist ein Lehrstück über Resilienz, Realismus und die transformative Kraft der Vergebung.