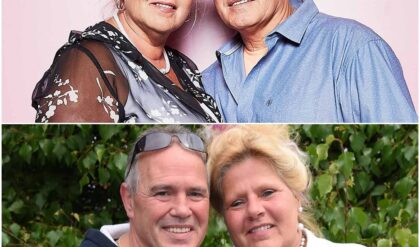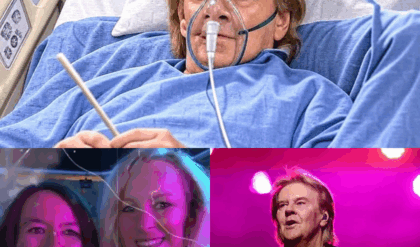Es ist ein politisches Beben, das Berlin in seinen Grundfesten erschüttert und weit über die Grenzen Deutschlands hinaus Wellen schlägt. Eine Nachricht, die so unglaublich scheint, dass sie zunächst wie eine Falschmeldung wirkt, verbreitet sich wie ein Lauffeuer: Bundeskanzler Olaf Scholz, der 66-jährige Regierungschef, das Symbol der Ruhe, Kontrolle und Disziplin, soll an einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leiden.
Die Enthüllung, die laut Berichten aus einem internen Papier stammt, das mehreren Medien zugespielt wurde, stellt das Bild des unerschütterlichen “Scholzomaten” radikal auf den Prüfstand. Der Mann, der Deutschland durch Pandemie, Ukrainekrieg und Energiekrise steuerte, soll selbst am Rande des Zusammenbruchs stehen.
Laut diesem vertraulichen Bericht soll sich der Kanzler bereits seit Monaten in psychologischer Behandlung befinden. Die Diagnose ist niederschmetternd. Ein Satz aus dem Papier wird zitiert: “Die Symptome deuten auf eine langhaltende stressbedingte Erschöpfung hin, verursacht durch dauerhafte Verantwortung und extreme politische Belastung.”

Plötzlich werden Bilder und Beobachtungen der letzten Monate, die bislang als Müdigkeit oder Anspannung abgetan wurden, in einem neuen, beklemmenden Licht gesehen. Abgeordnete erinnern sich an Auftritte, bei denen Scholz ungewöhnlich abwesend wirkte, die Hände nervös ineinander verschränkt hielt oder minutenlang ins Leere blickte. Ein Vorfall bei einem G7-Gipfel wird neu bewertet: Damals wirkte er sichtlich angespannt, die Lippen zusammengepresst, der Blick glasig. Heute wird es als mögliches Warnsignal interpretiert.
Die Fassade der Selbstbeherrschung, die Scholz über Jahrzehnte aufgebaut hat, scheint zu bröckeln. Insider und Mitarbeiter aus dem engeren Regierungsumfeld, die anonym bleiben wollen, zeichnen ein noch drastischeres Bild. Sie berichten von einer bemerkenswerten Gereiztheit, die der Kanzler besonders bei internen Sitzungen zu den Themen Ukraine und Haushaltskrise gezeigt haben soll. “Er wirkte oft, als trage er die ganze Last Europas allein auf seinen Schultern”, so ein Insider.
Mehr noch: Hinter den Kulissen, fernab der Kameras, soll der sonst so kühle und kontrollierte Kanzler mehrfach in Tränen ausgebrochen sein. Fotos, die nun in sozialen Netzwerken kursieren, scheinen diese Berichte zu stützen. Sie zeigen Scholz in seltenen Momenten der Verletzlichkeit, den Blick gesenkt, die Schultern leicht nach vorn gebeugt, das Gesicht von einer tiefen Müdigkeit gezeichnet.
Auch sein öffentliches Auftreten wurde zuletzt seltener und distanzierter. Bei einer Rede im Bundestag vor wenigen Wochen sprach er ungewöhnlich stockend, machte längere Pausen und suchte mehrmals nach Worten. Zuschauer beschrieben die Atmosphäre als “beklemmend still”. Spekulationen über gesundheitliche Probleme wurden damals von Regierungssprechern entschieden zurückgewiesen. Erst jetzt, mit der durchgesickerten Diagnose, ergibt vieles einen Sinn. In internen Protokollen aus dem Kanzleramt sollen Begriffe wie “Überlastung”, “Angstzustände” und “körperliche Erschöpfung” aufgetaucht sein.
Psychologen erklären die Symptome als typisch für Personen in extrem verantwortungsvollen Positionen, die über Jahre hinweg keine Pause zulassen. Medienanalysten sprechen von einem politischen Erdbeben. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik wurde ein amtierender Kanzler öffentlich mit einer solch schweren psychischen Erkrankung in Verbindung gebracht.
Die Nachricht trifft Deutschland in einer ohnehin heiklen Phase – steigende Unsicherheiten, sinkende Umfragewerte und wachsender Druck aus der Opposition. Die Frage, die nun im Raum steht, ist explosiv: Wie stabil ist der Kanzler wirklich?

Um zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, muss man den Weg von Olaf Scholz nachzeichnen – einen Weg, der geprägt ist von Krisen, die er meisterte, die ihn aber offenbar innerlich auszehrten.
Sein Ruf als “Scholzomat”, als kühler, emotionsloser Verwalter, entstand nicht über Nacht. Er begann in Hamburg, wo er als Erster Bürgermeister (2011-2018) regierte. Besonders die Bewältigung der G20-Unruhen 2017 machte ihn zum Symbol für Entschlossenheit. Während Barrikaden brannten, trat Scholz stoisch vor die Kameras und sagte: “Der Staat darf sich niemals erpressen lassen.”
Als Finanzminister unter Angela Merkel steuerte er das Land durch die Coronapandemie. Sein “Scholzplan”, ein milliardenschweres Hilfspaket, galt als Meisterstück der Stabilitätspolitik. Die Presse schrieb: “Er spricht leise, aber er bewegt Milliarden.” Doch hinter den Kulissen begann der Druck zu wachsen: nächtelange Krisensitzungen, ein permanenter Ausnahmezustand.
Der absolute Wendepunkt war der Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022. Scholz’ legendäre “Zeitenwende”-Rede ging in die Geschichte ein. Nüchtern, aber durchdrungen von einer seltenen Schwere, kündigte er massive Investitionen in die Verteidigung an. Millionen sahen einen Kanzler, gefasst, rational, unerschütterlich. Wie man heute glaubt zu wissen: innerlich bereits von der Last dieser Worte erdrückt.
Das öffentliche Bild des Mannes ohne Emotionen, des Staatsmanns aus Stahl, wurde zur Ikone. Sein unbewegtes Gesicht wurde zum Mythos. Jetzt, da Berichte über seine psychische Erschöpfung ans Licht kommen, wirkt dieses Bild nicht mehr wie ein Zeichen der Stärke, sondern, wie es in Berichten heißt, wie ein “stiller Hilfeschrei, den niemand hören wollte”.
Abseits der politischen Bühne führte Scholz ein Leben, das von fast militärischer Diskretion geprägt war. Sein Privatleben war der Anker seiner Selbstkontrolle. An seiner Seite steht seit Jahrzehnten Britta Ernst, ebenfalls SPD-Politikerin, oft als die “unsichtbare Stütze” des Kanzlers bezeichnet. Ihre Beziehung gilt als ungewöhnlich stabil in einem Umfeld voller Skandale. Sie kennen sich seit Jugendtagen, haben keine Kinder. Ihre Partnerschaft wirkt symbiotisch, auch wenn sie selten gemeinsam auftreten.
Ihr Haus in Potsdam war der Rückzugsort. Nachbarn berichten von einem Kanzler, der am frühen Morgen allein durch den Park joggt, den Blick auf den Boden gerichtet, “als wolle er Gedanken abschütteln”. Das Innere des Hauses soll geordnet, fast steril sein – ein Spiegel seines Charakters.
Vertraute erzählen, Britta Ernst habe wiederholt versucht, ihren Mann zu ermutigen, mehr Distanz zur Arbeit zu gewinnen, Reisen zu planen. Doch jedes Mal kam eine Krise dazwischen. “Er kann nicht abschalten”, soll sie einmal in einem vertraulichen Gespräch gesagt haben. “Sein Kopf ist immer noch im Kanzleramt, selbst wenn sein Körper längst auf der Couch sitzt.”
Auch das Fehlen eigener Kinder wurde oft thematisiert. In einem seltenen privaten Gespräch, Jahre vor seiner Kanzlerschaft, antwortete Scholz auf die Frage nach Familie mit dem knappen Satz: “Ich habe Verantwortung genug.” Heute klingt dieser Satz fast wie ein Bekenntnis zur inneren Einsamkeit.

Seine Wochenenden in Hamburg, manchmal inkognito, wirken wie Fluchtversuche. Ein Kellner aus einem Café in Altona erzählt, Scholz komme manchmal allein, bestelle einen schwarzen Kaffee, lese stundenlang in einem Buch, ohne ein Wort zu sagen, nicke kurz und verschwinde. Fragmente eines Mannes, der versuchte, Normalität zu bewahren, während der Apparat der Macht ihn zu verschlucken drohte.
Woher kommt diese eiserne Disziplin? Geboren 1958 in Osnabrück, aufgewachsen in einem Hamburger Arbeiterhaushalt, waren seine Werte Ordnung, Verantwortung und Leistung. Lehrer beschrieben ihn als den Jungen, “der immer zu viel denkt, aber nie redet”. Er studierte Jura, spezialisierte sich auf Arbeitsrecht und stieg stetig in der SPD auf.
Sein Spitzname “Scholzomat” entstand in den frühen 2000er Jahren, als er als Generalsekretär loyal die unpopuläre Agenda 2010 von Gerhard Schröder verteidigte – mit roboterhaftem Ernst. Er formte die Fähigkeit, Stürme zu überstehen, ohne sich zu bewegen. Ein Freund sagte einmal über ihn: “Er lernt Macht wie andere ein Instrument. Systematisch, Ton für Ton.”
Seine Biographie liest sich wie die Chronik eines Mannes, der alles verstand, außer vielleicht sich selbst. Ein Mechanismus, der perfekt funktionierte, bis, wie es scheint, eine unsichtbare Schraube brach.
Inmitten der Schlagzeilen und Spekulationen über seine Amtsfähigkeit bleibt eines oft vergessen: Hinter dem Titel “Bundeskanzler” steht ein Mensch. Ein Mensch, der jahrzehntelang Verantwortung trug und der jetzt, da seine Stärke Risse zeigt, vielleicht weniger Spott als Mitgefühl verdient. Die Geschichte von Olaf Scholz, so wie sie nun berichtet wird, ist nicht nur eine politische Tragödie, sondern eine zutiefst menschliche. Sie erinnert uns daran, dass Macht keinen Schutz vor Schmerz bietet und dass selbst jene, die unerschütterlich wirken, an den Grenzen ihrer eigenen Disziplin zerbrechen können.