Über Jahrzehnte hinweg galt Harald Schmidt als das intellektuelle Skalpell der Nation. Sein Zynismus war berühmt, seine Intelligenz gefürchtet, und sein Humor durchdrang die Oberfläche des deutschen Alltags wie ein scharfer Dorn. Er war der Mann, der aussprach, was andere nur dachten, der lächelte, während er die Welt gnadenlos auseinandernahm. Nun, im Alter von 68 Jahren, zieht der „Altmeister der Ironie“ Bilanz – und diese fällt nicht milde aus. Es geht nicht um einfache Unsympathie oder berufliche Differenzen. Es geht um tief verwurzelte Verachtung. Fünf Namen nennt Schmidt, fünf Giganten der deutschen Medienlandschaft, die es geschafft haben, sein scharfzüngiges Gehirn derart nachhaltig zu prägen, dass selbst er, der Meister der Distanz, keine Veranlassung mehr zur Belustigung findet. Diese Enthüllung ist weit mehr als eine Promi-Fehde: Sie ist eine intellektuelle Diagnose über den Zustand des Humors und der Haltung in Deutschland.

Stefan Raab: Der Trivialisierer der Kunst
Stefan Raab verkörperte für viele die Quintessenz des zeitgenössischen Entertainers – schlagfertig, ideenreich und stets darauf bedacht, das Publikum in Begeisterung zu versetzen. Für Harald Schmidt hingegen war Raab die Inkarnation dessen, was ihm von jeher widerstrebte. Der Konflikt zwischen den beiden war kein Streit um Einschaltquoten, sondern eine Auseinandersetzung unterschiedlicher Weltanschauungen: Subtilität gegen Explosivität, Reflexion gegen Trivialität. Schmidt schätzte Ruhephasen, Subtilitäten und den Moment, in dem ein Zuschauer erkannte, dass ein Witz nicht nur zur Belustigung, sondern auch der Reflexion diente. Raab hingegen war Impulsivität: ein explosionsartiges Geräusch, ein lautes Gelächter, die nächste Pointe.
Der endgültige Bruch kam in jener denkwürdigen Woche, in der Raab eine gesamte Sendung dem Phänomen Schmidt widmete – nicht zur Würdigung, sondern zur Nachahmung. Er imitierte Schmidts angedeutete Handbewegungen, sein stockendes Atmen, das melancholische Stirnrunzeln. Ein Millionenpublikum brach in schallendes Gelächter aus. Nur Schmidt nicht. In seiner Redaktion herrschte Ratlosigkeit. Für Schmidt war es kein Scherz; es war ein Angriff. Ihn beschlich das Gefühl, seine künstlerische Tätigkeit – denn er sah sich selbst als Künstler – auf ein Niveau von Jahrmarktsattraktionen herabgesetzt zu sehen.
Ein Jahr später, bei einer glanzvollen Gala in Berlin, kam es zum direkten Aufeinandertreffen. Raab, mit der Zuversicht des Siegers, konstatierte mit einem breiten Grinsen: „Nun Harald, man hat dich lange nicht mehr im Fernsehen gesehen. Ich hätte dich beinahe vergessen“. Ein Schlag, der für die Mehrheit unbedeutend schien, doch Schmidt verstand den unterschwelligen Tadel. Seine Antwort war frostig und präzise: „Ich dich niemals, bedauerlicherweise“. Der Höhepunkt dieser Fehde, der medial zum Sinnbild ihres Antagonismus wurde, ereignete sich bei einer Preisverleihung, bei der Schmidt ausgerechnet Raab einen Ehrenpreis überreichen sollte – eine geplante, symbolische Versöhnung. Schmidt betrat die Bühne, fixierte Raab und sagte mit einem Lächeln, das „die Kälte jeglicher Zuspitzung seiner Laufbahn übertraf“: „Gewisse Auszeichnungen werden nicht erworben, sie ereignen sich schlichtweg“. Nach der Übergabe des Preises ließ Schmidt die Trophäe fallen. Der Aufprall des Metalls auf der Bühne erzeugte einen Schall, der den Saal wie ein Messer durchschnitt. In der Stille danach, als Raab hinter der Bühne außer sich geriet und rief „Der Typ ist durch!“, entgegnete Schmidt lediglich: „Endlich gelangt diese Erkenntnis zu jemandem“. Raabs Humor sei „Konservensuppe: rasch, hitzig, jedoch ohne Substanz“. Es war eine Auseinandersetzung der Stilrichtungen, und der Sieger konnte niemals ermittelt werden, aber der Graben blieb unüberbrückbar.

Markus Lanz: Der Nebel der Perfektion
Der nächste Konflikt, der sich abzeichnete, war subtiler, doch nicht minder pointiert. Markus Lanz, im Gegensatz zum lauten Raab, überzeugte durch kontrolliertes Vorgehen, Ordnung, Disziplin und Ehrgeiz. Dies waren Eigenschaften, die Schmidt achtete. Was jedoch Schmidts Misstrauen erregte, war eine Perfektion, die „den Eindruck einer makellosen Oberfläche erweckte, unterhalb welcher keine weiteren Erkenntnisse zu gewinnen waren“. Schmidt kommentierte dies einst mit den Worten: „Man könne Glanz auch als Nebel einsetzen“.
Das erste Zusammentreffen in einer Talkshow schien einem psychologischen Experiment gleichzukommen: Was passiert, wenn der unbedingte Wunsch nach Kontrolle (Lanz) auf jemanden trifft, der sich willentlich jeder Kontrolle entzieht (Schmidt)? Lanz’ Fragen waren lehrbuchreif, präzise und einstudiert. Schmidt erwiderte mit spöttischer Arroganz und einem kalten Lächeln, das beredter war als jede verbale Äußerung. Lanz empfand dies als zutiefst persönliche Kränkung.
Ein Jahr später war Schmidt wieder Gast. Auf die übliche Anfrage der Redaktion nach Themenvorschlägen ließ Schmidt lediglich folgenden Satz verlauten: „Mein Thema ist Markus Lanz“. Die Sendung begann höflich, doch Schmidt fiel Lanz unvermittelt ins Wort, korrigierte dessen Betonnungen und kommentierte seine Formulierungen, „gleichsam als ob er der Lehrer und Lanz der Schüler wäre“. „Dies klingt, als hätten Sie es soeben memoriert“, höhnte Schmidt. Das Lächeln des Moderators gefror. Nach der Sendung soll Lanz verärgert geäußert haben, ein Gespräch mit Schmidt sei nicht möglich, sondern lediglich eine Auseinandersetzung. Schmidt konterte in einer Kolumne: Lanz habe Recht, jedoch führe er keine Waffen mit sich. Die Verachtung rührt daher, dass Lanz „Stille mit Tiefgründigkeit verwechselt“ – die perfekte Oberfläche ohne notwendige Substanz.
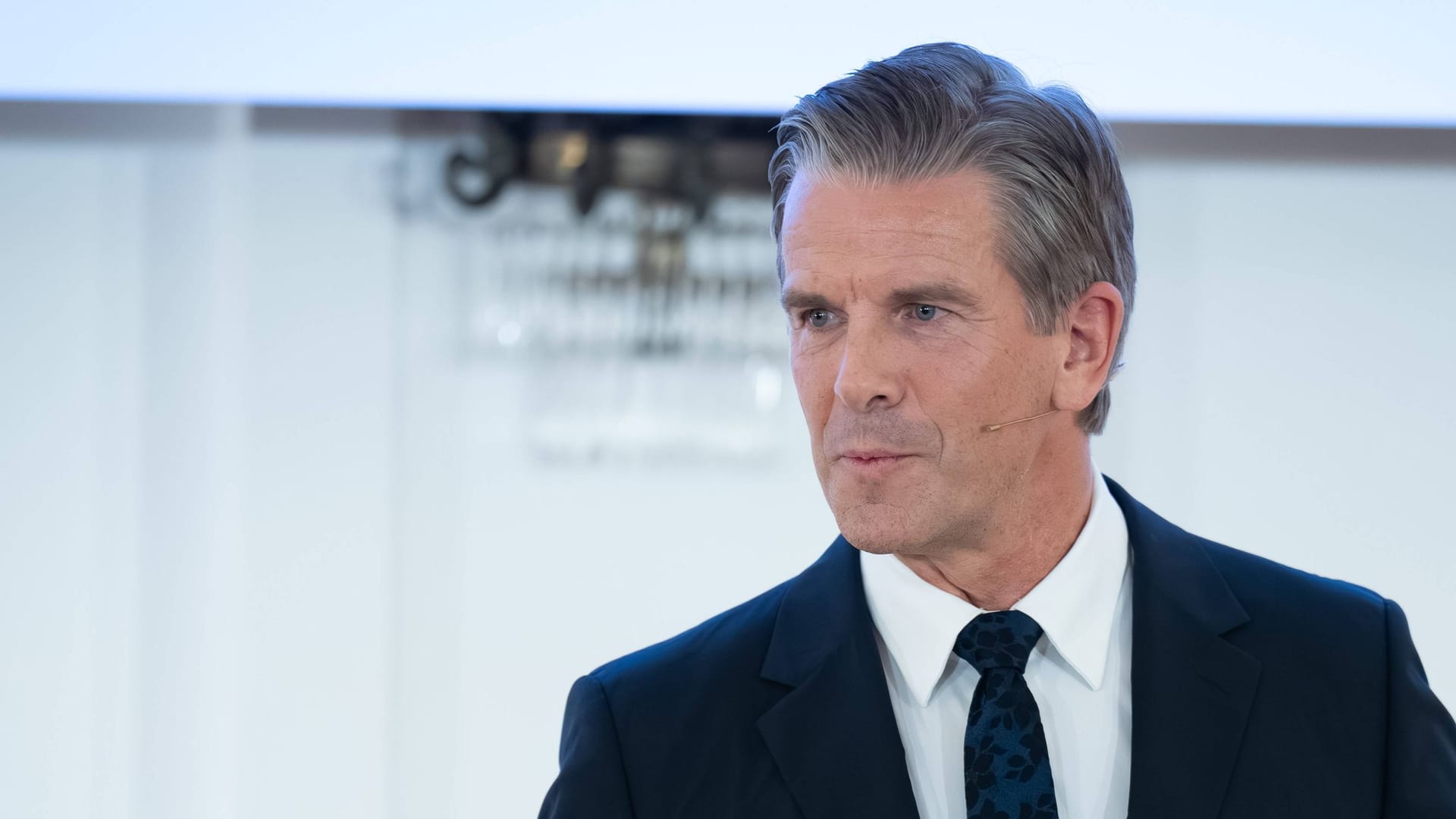
Hape Kerkeling: Der Primat des Gefühls
Die Beziehung zwischen Harald Schmidt und Harpe Kerkeling begann mit aufrichtiger Wertschätzung. Schmidt zollte Kerkelings kameleonsartiger Begabung zur Verwandlung große Anerkennung. Doch die ersten Unstimmigkeiten traten unerwartet schnell zutage. Bei einer Talkshow, in der Kerkeling sein neues Buch präsentierte, fragte der unaufgeforderte Zuschauer Schmidt lakonisch: „Es würde mich interessieren, inwieweit Harpe auch außerhalb der Bühne sein theatralisches Auftreten beibehält oder ob er irgendwann seine wahre Persönlichkeit offenbart“. Kerkeling verstummte, verließ das Studio ohne ein Wort und äußerte später: „Es ist zu beobachten, dass manche Menschen Intelligenz fälschlicherweise mit Gefühlskälte gleichsetzen“.
Der endgültige Bruch kam 2014 bei einem Sat.1-Jubiläum. Schmidt soll sich geweigert haben, in derselben Garderobe zu verbleiben. In einem späteren Interview lieferte Schmidt jedoch den Satz, der das Verhältnis nachhaltig belastete und das Zentrum seiner Verachtung für Kerkelings Stil enthüllte: „Harpe verfügt zwar über ein großes Herz, jedoch mangelt es ihm an der Fähigkeit zur Selbstzensur. Ich bevorzuge Menschen, die denken, bevor sie fühlen“. Für Schmidt ist die Fähigkeit zur Ironie – die Fähigkeit zur Distanz – der Maßstab der geistigen Reife. Kerkeling, so Schmidt spöttisch, verfüge über vielfältige Begabungen: „er kann singen, weinen und wandern – nur eines nicht: Ironie walten lassen“. Kerkeling, der selten den ersten Angriff führt, aber stets das letzte Wort behält, antwortete mit stiller, unmissverständlicher Eleganz bei einer Fernsehgala: „Ich schätze Personen, die im Fernsehen Urteile über andere fällen. Dies verdeutlicht, welch geringe Kenntnisse sie noch über sich selbst besitzen“. Was mit Bewunderung begann, mündete in einem Wettbewerb um Anerkennung zwischen zwei Männern, die einander in Wahrheit nie verstanden haben.
Anke Engelke: Die Störung der Umlaufbahn
Anke Engelke und Harald Schmidt wurden lange als das „ideale Gespann des deutschen Fernsehens“ betrachtet. Zwei Persönlichkeiten, die einander auf komplementäre Weise durchdrangen, vergleichbar dem Zusammenspiel von Licht und Schatten. Doch ihre Partnerschaft im Verborgenen gestaltete sich weniger als einvernehmliches Zusammenspiel, denn als Auseinandersetzung.
Der erste bedeutende Bruch offenbarte sich in Echtzeit vor einem Millionenpublikum, als Engelke während der Darbietung eine Szene improvisierte, welche Schmidts sorgfältig vorbereitete Pointe mühelos zunichtemachte. Hinter der Bühne herrschte betretene Stille. Die nächste Auseinandersetzung ließ nicht lange auf sich warten, als Engelke ihn während der Ausarbeitung eines Monologs unterbrach: „Überlass es mir. Ich vermag dies spontaner zu gestalten“. Schmidt verließ daraufhin den Raum.
Die dritte Auseinandersetzung trug sich in aller Öffentlichkeit zu, als Engelke gespöttisch über Schmidts vermeintlich „antiquierten Humor“ äußerte. Schmidt soll sich daraufhin geäußert haben: „Sollte im Fernsehen ausschließlich Applaus von Bedeutung sein, sehe ich meine Rolle dort als nicht länger gegeben an“. Es war kein beleidigter, sondern ein abschließender Tonfall. Der endgültige Bruch erfolgte unspektakulär, aber fatal, als Engelke in einem gemeinsamen Interview beiläufig anmerkte, Schmidt agiere zu kontrolliert, um wahrhaft witzig zu sein. Schmidt entgegnete lediglich: „Gewisse Personen mockieren sich über andere, da ihnen selbst jeglicher geistreicher Einfall fehlt“. Zwei ehemals gemeinsam strahlende Berühmtheiten, die sich nun voneinander entfernen, vergleichbar Planeten, deren Umlaufbahnen einer Störung unterlagen. Schmidts Verachtung hier: die Verteidigung der Kunst der Präzision gegen die Launen der Spontaneität, die er als mangelnden geistreichen Einfall interpretierte.

Jan Böhmermann: Der Spiegel der Unerwünschten Wahrheit
Sofern eine Person in der Nachfolge Harald Schmidts verortet wird, so ist dies Jan Böhmermann. Und genau dies begründete Schmidts dauerhafte Ablehnung. Schmidt betrachtete Böhmermann nicht als Nachfolger, sondern als einen Spiegel, dessen Reflexionen zu deutlich jenes Bild widerspiegelten, von dessen Richtigkeit Schmidt niemals überzeugt gewesen war: die Annahme, dass Provokation hinreichend sei, selbst wenn sie ohne Eleganz auskommt.
Böhmermann brachte bei einer Preisverleihung öffentlichkeitswirksam seine Verwunderung über Schmidts „musealen“ Zynismus zum Ausdruck. Schmidt, der alles vernahm, verharrte in seiner unbewegten Miene, doch abseits der öffentlichen Wahrnehmung wich das Lächeln einer ernsten Mine. Die zweite Auseinandersetzung entwickelte sich zu einem offenen Kräftemessen in einer Gesprächssendung, in der Böhmermann Schmidt wiederholt unterbrach und dessen Pointen mit einem schiefen, selbstgewissen Grinsen quittierte. Schmidt schien desillusioniert und seiner Grundlage beraubt.
Böhmermanns Demontage in einer Sondersendung des Rundfunks, in der er Schmidt lakonisch attestierte, „den Biss verloren“ zu haben und nur noch ein Relikt vergangener Zeiten darzustellen, rief Schmidts subtile, aber durchschlagende Erwiderung hervor: „Er ist der Auffassung Satire manifestiere sich in der Lautstärke. In der Tat handelt es sich um eine Geisteshaltung. Es mangelt ihm indes an Haltung“.
Die gravierendste Zuspitzung folgte bei einer Gala, bei der Böhmermann Schmidt ankündigen sollte. Böhmermann nutzte die Gelegenheit zu einer finalen Spitze, indem er Schmidt als den Mann bezeichnete, „der mich inspiriert hat, ohne sich dessen bewusst zu sein“. Schmidt betrat die Bühne, maß ihn eines kurzen Blickes und entgegnete mit frostiger Stimme: „Inspiration ist kein Nahrungsmittel. Ich präferiere Ergebnisse“.

Eine Intellektuelle Bilanz
Welche Schlussfolgerungen sind aus dieser Liste zu ziehen? Die fünf Namen – Raab, Lanz, Kerkeling, Engelke, Böhmermann – sind lediglich Repräsentanten einer intellektuellen Strömung, welche Schmidt zutiefst verabscheut.
Jeder von ihnen verkörpert einen Aspekt, der in Schmidts Weltbild keinen Platz findet: Raab die Oberflächlichkeit, Lanz die unreflektierte Penetranz, Kerkeling die unverarbeitete Emotionalität, Engelke die mangelnde Präzision, und Böhmermann die zur Schau gestellte, substanzlose Provokation. Schmidt führt einen ewigen Kampf für die Geisteshaltung, die Reflexion und die Subtilität in einer Medienlandschaft, die sich von schnellem Applaus, Lautstärke und dem Primat des Gefühls nährt. Die Liste der Verachteten ist daher kein Dokument der Eitelkeit, sondern ein tiefgründiges philosophisches Statement über das, was wahre Satire ausmacht, und darüber, wie viel davon in der modernen deutschen Unterhaltung noch übrig ist. Es ist die Bilanz eines Genies, der sich in einer von ihm nicht länger verstandenen Welt als Denkmal sieht – und der die Haltung verteidigt, die langsam verstaubt, aber niemals verrottet.





