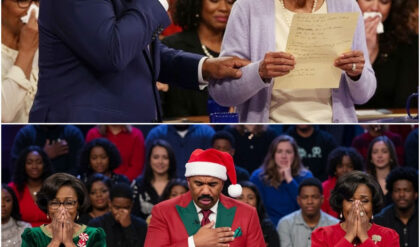Es gibt Momente im deutschen Fernsehen, die bleiben haften wie Kaugummi unter einem Schultisch – zäh, dauerhaft und meistens mit einem faden Beigeschmack. Und dann gibt es Momente, die einschlagen wie ein Blitz in eine ruhige See. Genau für letztere war Harald Schmidt, der selbsternannte „Dirty Harry“ des Late-Night-Talks, schon immer bekannt. Doch was der mittlerweile 68-Jährige nun offenbart, ist keine bloße Satire mehr. Es ist eine chirurgisch präzise Demontage. Jahrzehntelang hat er geschwiegen, gelächelt und seine spitzen Pfeile wohldosiert aus dem Hinterhalt abgefeuert. Doch nun öffnet er die Akten.
Er nennt fünf Namen. Fünf Giganten der deutschen Medienlandschaft, die er nicht nur professionell kritisiert, sondern – und das ist das Erschütternde – zutiefst verachtet. Es geht nicht um Quoten, es geht um Haltung, um Moral und um die Seele des Fernsehens selbst. Lassen Sie uns gemeinsam in diesen Abgrund blicken, den Schmidt nun so gnadenlos ausleuchtet.

Stefan Raab: Der „Lärmteppich“ ohne Seele
Wenn man an die 2000er Jahre denkt, kommt man an Stefan Raab nicht vorbei. Er war das laute, grelle Aushängeschild einer neuen Generation. Für Harald Schmidt jedoch war Raab nie ein Pionier, sondern ein Symptom des Verfalls. „Ein unlustiger Parasit mit lauter Stimme und ohne Tiefe“, so soll Schmidt ihn bezeichnet haben. Ein Urteil, das sitzt.
Der Konflikt zwischen den beiden war mehr als nur Konkurrenz; es war ein Kampf der Kulturen. Hier der intellektuelle Schmidt, der seine Pointen wie ein Fechtmeister setzte, dort der Metzgergeselle Raab, der mit dem Vorschlaghammer Humor erzwang. Der legendäre Moment bei der Verleihung des Fernsehpreises 2001, als Schmidt den Preis für Raab einfach fallen ließ, war keine Panne. Es war ein Statement. „Manche Preise werden nicht verdient, sie passieren einfach“, kommentierte Schmidt trocken, während die Trophäe dumpf auf den Boden krachte. Für Schmidt war Raab der „Heinz Schenk des digitalen Zeitalters“ – jemand, der Lärm kuratiert und es Fernsehen nennt. Dass Raab später Millionen scheffelte, änderte für Schmidt nichts an der Tatsache, dass ihm das Wichtigste fehlte: künstlerische Substanz.

Markus Lanz: Die Simulation von Tiefe
Noch härter trifft es Markus Lanz. Während Raab zumindest als anarchischer Clown durchging, verkörpert Lanz für Schmidt das absolute Vakuum. „Die Präsenz eines Bildschirmschoners und die Tiefe einer Pfütze“ – vernichtender kann man einen Talkmaster kaum beschreiben. Schmidt verachtet an Lanz vor allem dessen Vortäuschung von Journalismus.
Wer erinnert sich nicht an die Begegnungen der beiden? Schmidt, der Lanz‘ Fragen wie lästige Fliegen verscheuchte und mit einer Stoppuhr maß, wie lange der Moderator brauchte, um „absolut nichts zu sagen“. Für Schmidt ist Lanz ein Darsteller, der Betroffenheit spielt, sobald das Rotlicht der Kamera angeht. „Du bist kein Journalist, Markus. Du bist ein Moderator mit guter Beleuchtung.“ Dieser Satz entlarvt die gesamte Maschinerie der modernen Talkshow, in der es nicht um Erkenntnis geht, sondern um die Inszenierung von Wichtigkeit. Schmidt sah in Lanz nie einen Gesprächspartner, sondern ein Studienobjekt für die Banalität des Bösen im Unterhaltungsformat.

Oliver Pocher: Das „adipöse Ex-Talent“
Die wohl schmerzhafteste Episode in Schmidts Karriere trägt den Namen Oliver Pocher. Was als Experiment begann – der Meister der Ironie trifft auf den jungen Wilden – endete in einer Katastrophe, die Schmidt heute als seine „Phase intellektueller Dunkelheit“ bezeichnet. Doch die Verachtung für Pocher speist sich nicht nur aus dem Scheitern der gemeinsamen Show.
Es war der Moment mit „Lady Bitch Ray“, der das Fass zum Überlaufen brachte. Als Pocher versuchte, einer norwegischen Sängerin ein Glas mit angeblichen Körperflüssigkeiten aufzudrängen, griff Schmidt ein. Er nannte Pocher einen „kleinen, gemeinen, unbedeutenden Mann“. Für Schmidt, der Satire als Kunstform begreift, war Pochers Verhalten schlichtweg Vandalismus. Pocher, so Schmidt, habe nie verstanden, dass Provokation ohne Intelligenz wertlos ist. Die Bezeichnung „adipöses Ex-Talent“ ist dabei noch einer der charmanteren Seitenhiebe. Schmidt sah in Pocher jemanden, der den unausgesprochenen Ehrenkodex der Unterhaltung verletzt: Man darf böse sein, aber man darf niemals dumm sein. Pocher war für ihn Lärm – und Lärm hat in der Satire keinen Platz.

Johannes B. Kerner: Der Händler der Emotionen
Doch wenn es eine Figur gibt, die Schmidt nicht nur aus ästhetischen, sondern aus tief moralischen Gründen verachtet, dann ist es Johannes B. Kerner. Hier wird der Zyniker Schmidt plötzlich ernst, fast schon staatsmännisch. Der Bruch geschah im Nachgang des Massakers von Erfurt im Jahr 2002.
Kerner interviewte damals ein traumatisiertes Kind in einer Sondersendung. Für Schmidt war dies der ultimative Sündenfall: Die Instrumentalisierung von menschlichem Leid für die Quote. „Wenn eine Tragödie passiert, brauchen Menschen keinen Scheinwerfer“, sagte Schmidt damals und boykottierte eine Preisverleihung, die von Kerner moderiert wurde. Für Schmidt ist Kerner der Typ Mensch, der „eine Kerze am Mahnmal anzündet und sie dann zum Kameraobjektiv hindreht“. Diese Kritik trifft ins Mark, weil sie die Scheinheiligkeit einer ganzen Branche entlarvt. Kerner steht für Schmidt für die „ZDF-Version eines Software-Updates: Unerwünscht, verwirrend und irgendwie immer wieder da“. Es ist eine Verachtung, die aus einem tiefen Humanismus rührt – der Überzeugung, dass es Grenzen gibt, die man für keine Einschaltquote der Welt überschreiten darf.
Jan Böhmermann: Der gescheiterte Sohn
Vielleicht am tragischsten ist das Verhältnis zu Jan Böhmermann. Einst als Schmidts legitimer Erbe gehandelt, ist er heute für den Altmeister nur noch ein „Chaosclown“. Böhmermann wollte Macht nicht kritisieren, er wollte sie ersetzen – durch sich selbst.
Der Streit entzündete sich am berühmten Erdogan-Gedicht. Wo viele einen mutigen Akt der Satire sahen, erkannte Schmidt nur Kalkül. „Es ist keine Satire, wenn das Hauptziel ist, auf Twitter zu trenden.“ Für Schmidt verwechselt Böhmermann Lautstärke mit Witz und Hashtags mit Erkenntnis. Als Böhmermann ihn einst als Inspiration bezeichnete, konterte Schmidt eiskalt: „Inspiration zahlt keine Miete. Ich bevorzuge Ergebnisse.“ Schmidt sieht in Böhmermann den Sieg des Spektakels über den Intellekt, eine „moralinsaure“ Version von Unterhaltung, die mehr predigt als unterhält. Die Enttäuschung darüber, dass sein potenzieller Nachfolger den Pfad der feinen Klinge verlassen hat, um mit der Keule der Empörungsmaschinerie zu schwingen, sitzt tief.

Fazit: Ein Vermächtnis der Ehrlichkeit
Mit 68 Jahren hat Harald Schmidt nichts mehr zu verlieren und nichts mehr zu beweisen. Seine Abrechnung ist kein Rachefeldzug eines verbitterten Alten, sondern das Resümee eines Mannes, der sein Handwerk mehr liebte als den Ruhm. Er hält der deutschen Fernsehlandschaft einen Spiegel vor – und das Bild, das sich darin zeigt, ist alles andere als schmeichelhaft.
Die fünf Namen auf seiner Liste stehen stellvertretend für alles, was im modernen TV schiefläuft: Opportunismus, Oberflächlichkeit, Dummheit, Morallosigkeit und Eitelkeit. Schmidt mag sich aus dem aktiven Dienst zurückgezogen haben, aber seine Worte wirken nach wie ein Donnerhall. Er bleibt der Papst, während die anderen nur versuchen, in seiner Kirche den Klingelbeutel zu füllen. Und vielleicht ist genau das die wichtigste Lektion, die wir aus dieser „Ultimativen Expedition“ in Schmidts Gedankenwelt lernen können: Wahre Größe zeigt sich nicht in der Quote, sondern in der Haltung, die man bewahrt, wenn das Rotlicht ausgeht.