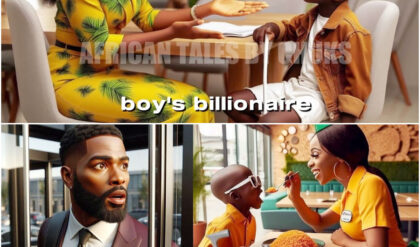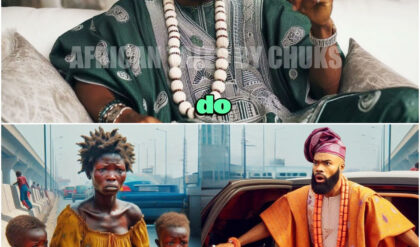Es gibt Karrieren, die wie ein klares, ruhiges Gewässer verlaufen. Und dann gibt es das Leben des Matthias Reim. Eine Geschichte, die so dramatisch, so voller unglaublicher Höhen und vernichtender Tiefen ist, dass sie wie das Drehbuch eines Hollywood-Films wirkt. Er ist der Mann, der den größten Hit der deutschen Nachkriegsgeschichte landete, ein Phänomen, das eine ganze Generation prägte. Und er ist derselbe Mann, der am Abgrund stand, mit über 13 Millionen Euro Schulden, von der Presse gejagt und von der Industrie fast abgeschrieben.
Doch Matthias Reim ist mehr als nur ein Sänger; er ist ein Symbol für das deutsche Gemüt, für das Scheitern, das Hinfallen und vor allem für das unbedingte Wiederaufstehen. Um dieses Phänomen zu verstehen, muss man ganz von vorne anfangen.

Die stillen Anfänge eines Rebellen
Geboren am 26. November in der hessischen Kleinstadt Korbach, wuchs Matthias Reim in einem Umfeld auf, das auf den ersten Blick so gar nicht zu seiner späteren Karriere passen wollte. Sein Vater, ein Gymnasialrektor, legte Wert auf Bildung. Reim folgte dem Pfad und schrieb sich an der Georg-August-Universität Göttingen für Germanistik und Anglistik ein. Doch während die Hörsäle auf ihn warteten, brannte sein Herz für etwas anderes: die Musik.
Die meiste Zeit seines Studiums verbrachte er nicht mit Büchern, sondern in Studentenkneipen, mit Demos und in kleinen Bands. Seine Leidenschaft war so groß, dass sein Studium sich auf erstaunliche 18 Semester dehnte – ein klares Zeichen, dass sein Weg nicht in einen akademischen Beruf, sondern auf die Bühne führen würde. Er entschied sich, alles auf die Kunst zu setzen.
Die 1980er Jahre waren hart. Reim arbeitete hinter den Kulissen, ein unsichtbarer Motor der deutschen Musikszene. Er war ein fleißiger Songwriter und Produzent für etablierte Schlagergrößen wie Bernhard Brink und Roberto Blanco. Er experimentierte, gründete Bands mit Namen wie Fallen Dice und Fairfex, tauchte in den Synthpop-Stil ein, aber der persönliche Durchbruch blieb aus. Diese Projekte machten ihn nicht zum Star, aber sie statteten ihn mit unschätzbarer Erfahrung aus. Es war eine Zeit des Kämpfens. Er gab später zu, dass er sich oft Geld leihen musste, nur um sein kleines Studio am Laufen zu halten. Die verkauften Lieder reichten einfach nicht aus.
Der Urknall: „Verdammt, ich lieb‘ dich“
Inmitten dieser finanziell und kreativ oft zermürbenden Zeit, in einem kleinen Studio in Stockach, schrieb er 1981 einen Song, der alles verändern sollte. Der Song hieß „Verdammt, ich lieb‘ dich“.
Zunächst wollte ihn niemand. Die Plattenfirmen winkten ab. Die Melodie zu schlicht, der Text zu repetitiv, das Ganze galt als “rustikal” im Vergleich zu den internationalen Trends. Doch als Polydor den Song schließlich veröffentlichte, explodierte er. Es war kein Hit, es war ein nationales Phänomen.
Innerhalb kürzester Zeit schoss „Verdammt, ich lieb‘ dich“ an die Spitze der deutschen Charts und blieb dort – 16 Wochen in Folge. Ein Rekord, den es so in der Nachkriegs-Schlagergeschichte noch nie gegeben hatte. Der Song eroberte Österreich, die Schweiz, Belgien, die Niederlande. Matthias Reim wurde buchstäblich über Nacht vom verschuldeten Studiomusiker zum nationalen Superstar.
Sein Debütalbum „Reim“ verkaufte sich millionenfach. Mit seinen langen blonden Haaren, der Jeans, der Lederjacke und der E-Gitarre definierte er das Image des Schlagers neu. Er machte ein Genre, das als altmodisch galt, plötzlich jugendlich, rockig und sexy. Die frühen 90er waren Reims goldene Ära. Alben wie „Reim 2“ und „Sabotage“ wurden Bestseller, er spielte Hunderte von Konzerten vor Tausenden von Fans. Er war eine Mischung aus tief empfundener Emotion und purer Rockenergie. Er war auf dem Gipfel des Olymps.

Der tiefste Fall: 13 Millionen Euro Schulden
Doch der Glanz des Ruhms hat oft die dunkelsten Schatten. Während Reim auf der Bühne triumphierte, zog sich hinter den Kulissen ein finanzielles Unwetter zusammen. Aufgrund von katastrophalem Management, wie er es später beschrieb, geriet er in eine Abwärtsspirale. Er hatte eine Reihe unrentabler Verträge unterzeichnet und die gesamte Finanzkontrolle an seinen Manager Alfred Reimann abgegeben.
Es folgten desaströse Investitionen in Immobilien, Restaurants und Plattenläden, die alle scheiterten. Und da alles auf seinen Namen lief, fielen die Schulden auf ihn zurück. Anfang der 2000er Jahre war die Blase geplatzt. Matthias Reim, der Mann der Millionen-Hits, war bankrott. Die Schuldensumme: über 13 Millionen Euro.
Es war ein Fall, der tiefer kaum hätte sein können. Er verlor fast alles – sein Haus, sein Auto, sein Studio. Die Medien, die ihn eben noch als “Matthias Reim-Phänomen” gefeiert hatten, stürzten sich auf ihn. Eine Zeitung nannte ihn den “Mann mit 13 Millionen Euro Schulden”, ein Titel, der seinem Image schwer schadete. Reim zog sich zurück, lebte in einem kleinen Mietshaus am Bodensee und konzentrierte sich auf das Einzige, was ihm geblieben war: das Schreiben von Musik.
Die Wiederauferstehung: Das Matthias-Reim-Wunder
Viele wären an diesem Punkt zerbrochen. Doch Reim gab nicht auf. Um 2003 kehrte er langsam auf die Bühne zurück, unterschrieb einen neuen Vertrag und veröffentlichte das Album „Reim 2003“. Die Musik war anders. Sie war reifer, düsterer, gezeichnet von den Erfahrungen des Zusammenbruchs. Lieder wie „Ich habe geträumt von dir“ wurden zu Bekenntnissen eines Mannes, der alles verloren hatte.
Der wahre Paukenschlag seines Comebacks kam 2013, mehr als zwei Jahrzehnte nach seinem Debüt. Sein Album „Unendlich“ stieg auf Platz 1 der deutschen Charts. Es war das erste Mal seit 1990, dass ihm dies gelang. Es war nicht nur ein kommerzieller Erfolg; es war die symbolische Wiederauferstehung aus der Schuldenkrise. Die deutsche Presse, die ihn einst zerrissen hatte, feierte nun das “Matthias Reim-Wunder”.
Er hatte es geschafft. Er hatte alle Schulden beglichen und war zurück an der Spitze. Er kehrte zu einem einfacheren Leben zurück, zog an den Bodensee, baute ein neues Leben mit seiner Familie und seiner Frau, der Sängerin Christin Stark, auf. Er strebte nicht mehr nach Luxus, sondern nach dem, was er immer wollte: komponieren und auftreten.

Der authentische Kern eines Idols
Was macht diesen Mann so unverwüstlich? Warum lieben ihn seine Fans mit einer fast schon religiösen Inbrunst? Die Antwort, so zeigt seine Geschichte, liegt in einem Wort: Authentizität.
In den Herzen der deutschen Öffentlichkeit ist Reim kein polierter Popstar. Er ist das Symbol eines Sängers, der es wagt, seine Wahrheit zu leben, seinen Schmerz nicht zu verbergen und Perfektion nicht zu beschönigen. Als „Verdammt, ich lieb‘ dich“ erschien, hörten die Menschen nicht nur einen Song; sie spürten die Rauheit, die Bitterkeit und die unbändige Leidenschaft in seiner Stimme. Er war kein Erzähler von idealer Liebe, sondern von wahrer Liebe – mit all ihren Fehlern, ihrer Reue und ihrem Schmerz.
Als er nach seiner Insolvenz auf die Bühne zurückkehrte, applaudierte das Publikum nicht nur für die Musik, sondern für seine schiere Widerstandsfähigkeit. Ein Zuschauer fasste es einmal treffend zusammen: “Matthias Reim singt nicht nur für uns, er singt für uns, was wir nicht zu sagen wagen”.
Selbst Kollegen und Branchenkenner, die seine Musikstruktur manchmal als wenig innovativ kritisierten, mussten seine Wirkung anerkennen. Jüngere Stars wie Helene Fischer oder Andrea Berg bezeichnen ihn als Pionier, der den Schlager für ein junges, rockiges Publikum öffnete. Er ist bekannt als Perfektionist im Studio, aber auch als ein Mann, der trotz Ruhm und Misserfolg jeden Techniker und Musiker mit Respekt behandelt.
Sein Privatleben war oft turbulent, ein Wechselbad der Beziehungen, was ihm Kritik einbrachte. Doch seine Fans sahen selbst darin nur einen Ausdruck seiner liberalen, künstlerischen und vor allem ehrlichen Natur. Sie verurteilten ihn nicht; sie fühlten mit ihm.
Heute, mit über 60 Jahren, steht Matthias Reim immer noch mit der Energie eines jungen Mannes auf der Bühne. Jüngere Fans nennen ihn liebevoll “Onkel Rockenschlager”. Er trägt immer noch Lederjacke, spielt E-Gitarre und beweist, dass es nie zu spät ist, seine Leidenschaft zu leben. Er hat den tragischen Verlust seines ersten Sohnes überstanden und sagt, Musik sei der einzige Weg, mit diesem Schmerz umzugehen.
Matthias Reim ist kein perfektes Symbol. Aber gerade diese Unvollkommenheit macht ihn zu einer Identifikationsfigur. Die Menschen sehen in ihm sich selbst: einen Menschen, der stolpert, wieder aufsteht, falsch liebt, verliert und trotzdem weitermacht. Für Deutschland ist er nicht nur ein Künstler. Er ist seit mehr als drei Jahrzehnten ein Teil der Seele dieses Landes.