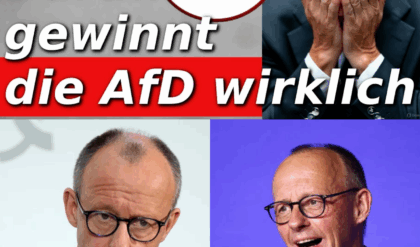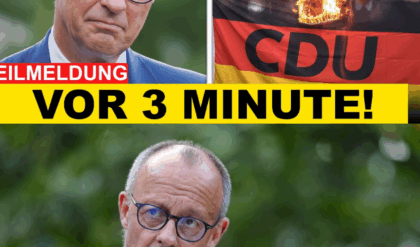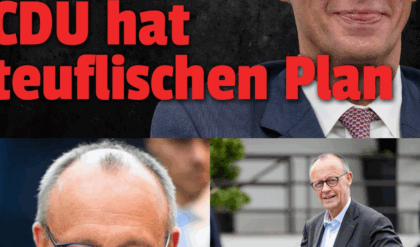In den Hallen der Macht, dort, wo die finanziellen Geschicke Deutschlands gelenkt werden sollten, gärt es. Ein Aufstand, nicht laut und plakativ, sondern ein stilles, aber verheerendes Urteil aus den eigenen Reihen. Im Zentrum der Kritik: Lars Klingbeil, der Mann, der drei der mächtigsten Ämter der Republik auf sich vereint. Er ist SPD-Vorsitzender, Vizekanzler – oder genauer, wie es das Grundgesetz in Artikel 69 vorschreibt, „Stellvertreter des Bundeskanzlers“ – und Bundesfinanzminister. Doch genau diese Ämterhäufung scheint nun zu einem Desaster zu führen. Aus dem Inneren seines eigenen Ministeriums und aus Kreisen der Finanzbranche dringen Berichte, die ein erschütterndes Bild zeichnen: Ein Minister, der mit den Kernthemen seines Ressorts “ganz wenig anfangen” könne. Ein Chef, der als “Teilzeit-Minister” verspottet wird.
Die Vorwürfe, die durch einen detaillierten Bericht im Handelsblatt an die Öffentlichkeit gelangten, sind massiv. Sie treffen den Nerv einer Nation, die sich in einer prekären wirtschaftlichen Lage befindet. Die Kernlast der Kritik: Die fachliche Arbeit im Bundesministerium der Finanzen, dem Herzstück der deutschen Wirtschaftspolitik, bleibe auf der Strecke. Klingbeil, so der Tenor, sei ein Getriebener seiner eigenen Ambitionen, ein Jongleur, der zu viele Bälle gleichzeitig in der Luft hält und dabei den wichtigsten fallen lässt: die Verantwortung für den Bundeshaushalt und die Stabilität der Staatsfinanzen.

Die Anschuldigungen kommen nicht von der politischen Konkurrenz, sondern von jenen, die es wissen müssen: Branchenvertreter und, was besonders schwer wiegt, Mitarbeiter seines eigenen Hauses. Sie beklagen, dass Klingbeil für dieses Amt schlicht nicht der Richtige sei. Er bekomme es “offensichtlich nicht hin”. Es ist das Bild eines Mannes, der zwar die Titel anhäuft, der Verantwortung aber nicht gerecht wird.
Noch alarmierender sind die Schilderungen über den Arbeitsalltag des Ministers. Interne Sitzungen, so wird berichtet, verlasse Klingbeil regelmäßig, sichtlich gelangweilt. Der Vorwand seien “vermutlich fingierte Anrufe”. Ein Muster soll sich etabliert haben: Wird der Minister mit zu vielen Details konfrontiert, mit den komplexen Zahlenwerken und Fakten, die das Fundament der Finanzpolitik bilden, klingelt angeblich das Telefon. “Wieder ein Anruf vom Bundeskanzler”, scherze man bereits sarkastisch im Detlev-Rohwedder-Haus, dem ehrwürdigen Sitz des Ministeriums. Ein Minister auf der Flucht vor den eigenen Aufgaben? Ein Chef, der Details als lästige Unterbrechung empfindet?
Dieses Bild des Desinteresses setzt sich fort. Für die Beamten, die die eigentliche Knochenarbeit leisten, sei der selbsternannte “Investitionsminister” nur schwer erreichbar. Besonders während des Kommunalwahlkampfes in Nordrhein-Westfalen habe er das Haus “selten besucht”. Zu selten, wie es heißt. Ein Ministerium, das führungslos agiert, während der Chef auf Parteiveranstaltungen und Wahlkampfbühnen präsent ist? Es ist ein Vorwurf, der an den Grundfesten seines Amtsverständnisses rüttelt.
Die vielleicht gravierendste Beobachtung betrifft Klingbeils Auftritte im parlamentarischen Betrieb. Im Haushaltsausschuss, dem kritischsten Gremium, wenn es um das Geld der Bürger geht, soll Klingbeil bei Fachfragen regelmäßig abtauchen. Statt selbst Rede und Antwort zu stehen, überlasse er das Feld bevorzugt seinem Staatssekretär. Beobachter aus der Opposition reiben sich die Augen. Ein solches Verhalten, so heißt es, hätte es unter seinen Vorgängern – ob Wolfgang Schäuble, Olaf Scholz oder Christian Lindner – nicht gegeben. Diese hätten sich den Details gestellt, hätten argumentiert und ihre Politik verteidigt. Klingbeil hingegen, so der Eindruck, weiche aus. Er delegiert die Verantwortung dorthin, wo die Expertise liegt, die ihm selbst angeblich fehlt.
Aus dem Umfeld des SPD-Chefs wird versucht, diese offenkundige Schwäche in eine Stärke umzudeuten. Ja, Klingbeil fühle sich “noch nicht sattelfest”, heißt es da. Aber das mache ihn doch “beratungsempfänglich”. Ein erstaunliches Argument. Der Mann, der das finanzielle Gewissen der Nation sein sollte, wird als eine Art Lernender dargestellt, der offen für Ratschläge sei. Seine Amtsführung sei eben “stärker politisch”. Man versucht, das Bild eines Managers zu zeichnen, der die großen Linien vorgibt, statt sich im Klein-Klein zu verlieren. Doch die Kritiker sehen darin nur eine billige Ausrede. Sie verweisen auf die Prioritäten, die der Minister selbst zu setzen scheint: Sein Leben als Bayern-Fan, als Musiker und – eine Information, die für besonderes Kopfschütteln sorgt – als “Kraftsportler” wolle er weiterführen. Ein Minister, der mehr Zeit im Fitnessstudio als über den Haushaltsakten verbringt?

Die Frage nach der fachlichen Eignung führt unweigerlich zu einem Blick auf den Lebenslauf von Lars Klingbeil. Geboren 1978, Abitur, Zivildienst. Dann das Studium: Politische Wissenschaft, Soziologie und Geschichte. Ehrenwerte Fächer, keine Frage. Doch was folgt, ist eine reine Parteikarriere. Mitarbeiter im Wahlkreisbüro von Gerhard Schröder, Jugendbildungsreferent, Büroleiter eines Abgeordneten, Generalsekretär, Parteivorsitzender. Es ist eine Karriere, die ausschließlich im politischen Biotop stattfand. Nicht ein Tag, so die Kritiker, habe Klingbeil in der freien Wirtschaft verbracht. Nicht fünf oder zehn Jahre Selbstständigkeit, kein Verständnis für Bilanzen, für unternehmerisches Risiko, für die Realität jener, deren Geld er nun verwaltet.
Hier, so argumentieren viele, liege der Kern des Problems. Es sei die Arroganz einer politischen Kaste, die glaube, ein Land wie ein Parteibüro führen zu können. Die Realität, die tagtäglich auf den Straßen sichtbar wird, sei das Ergebnis genau dieser Abgehobenheit. Man sieht, was passiert, wenn Ideologen ohne praktische Erfahrung die Kontrolle über komplexe Systeme wie eine Volkswirtschaft übernehmen. Ein harter Vorwurf, der weit über die Person Klingbeil hinausgeht und ein systemisches Versagen anprangert.
Wie ein Akt aus einer politischen Tragikomödie wirkt vor diesem Hintergrund Klingbeils jüngste Reise in die USA. Dort, bei den großen Finanzmanagern, warb der deutsche Finanzminister um Investitionen. 120 Milliarden – ob Euro oder Dollar, bleibt unklar – wolle er nach Deutschland locken. Eine gigantische Summe, eine Geste des Aufbruchs. Doch in der Heimat wird dieser Vorstoß als “unglaubwürdiger Schwachsinn” abgetan. Die Kommentatoren überschlagen sich in Sarkasmus: Wer, bei klarem Verstand, wolle denn in diesem Land auch nur einen einzigen Euro noch investieren?
Die Diskrepanz zwischen Klingbeils PR-Tour und der wirtschaftlichen Realität könnte größer nicht sein. Während der Minister in Übersee für den Standort Deutschland wirbt, zeichnen aktuelle Umfragen ein Bild des Grauens. 94 Prozent der Unternehmen befürchten eine Abwanderung der Industrie. 63 Prozent stellen ihre Investitionen bereits aktiv zurück. Sie “kürzen”, wie es ungeschönt heißt. Das ist die Realität, der sich der Finanzminister stellen müsste. Stattdessen verkauft er eine Fata Morgana.

Der Grund für die Investitionszurückhaltung ist simpel: Das Risiko in Deutschland ist “mega hoch”. Ein Investor wägt immer zwei Dinge ab: das eingesetzte Kapital und den potenziellen Ertrag. Dazwischen steht das Risiko. Und diese Waage ist in Deutschland massiv aus dem Gleichgewicht geraten. Bürokratie, hohe Energiepreise, Fachkräftemangel und eine unberechenbare Politik haben das Risiko so weit nach oben getrieben, dass zahlreiche andere Länder längst attraktivere Konditionen bieten. Deutschland, einst als Hort der Stabilität gepriesen, ist auf dem besten Weg, zum Sanierungsfall zu werden.
In diesem Kontext gewinnt eine Randnotiz aus der aktuellen Debatte an Gewicht. Ein kurzes, fast zähneknirschendes Lob für Klingbeils Vorgänger, Christian Lindner. Lindner, bei Weitem kein unumstrittener Politiker, habe zumindest eines richtig gemacht: Er hat seine Unterschrift unter den “grausamen” Haushalt 2024 nicht gesetzt. Ein Akt des Widerstands, der ihm nun, im Rückblick auf die angebliche Ahnungslosigkeit seines Nachfolgers, hoch angerechnet wird. Es zeigt, dass die Kritik an Klingbeil nicht parteipolitisch motiviert ist, sondern sich an einer fundamentalen Sorge um die Kompetenz an der Spitze des wichtigsten Ministeriums entzündet.
Was bleibt, ist ein Gefühl der Fassungslosigkeit. Ein Finanzminister, der vor Details flieht, der im eigenen Haus kaum präsent ist und dessen fachliche Qualifikation offen in Zweifel gezogen wird. Ein Land, das um Investitionen bettelt, während die eigene Wirtschaft die Koffer packt. Die Frage “Was regiert uns da eigentlich?” hallt durch die Gänge des Ministeriums und die sozialen Medien. Sie ist der Ausdruck einer tiefen Vertrauenskrise. Wenn der Mann, der die Kasse hütet, offensichtlich nicht zählen kann – oder will –, steht die Zukunft des gesamten Standorts auf dem Spiel.