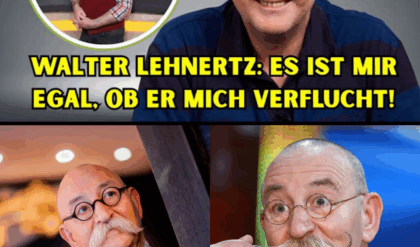Der pragmatische Pakt im Osten: Wie ein kleines Duo die deutsche Politik spaltet
In der beschaulichen brandenburgischen Gemeinde Steinhöfel, einem Ort mit kaum mehr als 4.300 Seelen, hat sich ein politisches Erdbeben ereignet, dessen Schockwellen bis in die Berliner Parteizentralen reichen. Was auf den ersten Blick wie eine lokale Randnotiz anmutet, ist in Wahrheit ein beispielloser Akt der politischen Subversion und ein direkter Angriff auf das in Deutschland sakrosankte Konzept der sogenannten „Brandmauer“. Hier, abseits der großen Bühnen der Bundespolitik, haben zwei Kommunalpolitiker – eine Vertreterin der Partei Die Linke und ein Mandatsträger der AfD – die ideologischen Gräben der Republik demonstrativ zugeschüttet und eine gemeinsame Fraktion ins Leben gerufen.
Die beiden Gemeindevertreter, Bettina Lehmann von der Linken und Matthias Natusch von der AfD, vollzogen mit diesem Schritt nicht nur einen Tabubruch; sie setzten ein Signal für eine Art des politischen Pragmatismus, der in der Bundesrepublik als nahezu ausgestorben galt. Ihre neue Allianz gaben sie selbstbewusst den Namen: „Vernunft und Verantwortung“.
Dieser Name ist Programm und Provokation zugleich. Er impliziert, dass dort, wo andere Parteien ideologische Scheuklappen tragen und künstliche Barrieren errichten, sie den Fokus auf das Wesentliche lenken: die praktischen Herausforderungen des ländlichen Raumes. Die Begründung für den Pakt liest sich wie eine Kampfansage an das Dogma der politischen Reinheit: „Wir gründen uns, weil unsere gemeinsamen Schnittmengen zu deutlich sind, um sie durch künstliche Grenzen zu ignorieren“, hieß es in ihrer gemeinsamen Stellungnahme.

Ihre Ziele sind tief in der lokalen Realität verankert: eine funktionierende Infrastruktur, die Pflege einer lebendigen Dorfgemeinschaft, eine verlässliche Daseinsvorsorge und vor allem die verdiente Wertschätzung des Ehrenamtes. Hier geht es nicht um NATO-Osterweiterung oder Klimasteuern, sondern um den lokalen Springbrunnen, die Ansiedlung neuer Firmen und darum, dass der Bus fährt. Es ist die Politik der Dinge, die zählen, nicht die Politik der großen, abstrakten Erzählungen.
Der entscheidende Vorteil dieses Duos: Als Fraktion in der Gemeindevertretung Steinhöfel genießen Lehmann und Natusch nun deutlich mehr Rechte und vor allem Mittel als zuvor als fraktionslose Einzelkämpfer. Sie können Anträge effektiver einbringen, haben Anspruch auf zusätzliche Gelder und können ihre Arbeit mit professionellerer Unterstützung versehen. Es ist ein Akt der politischen Selbstermächtigung im Interesse der Gemeinde.
Doch die Vernunft, die sie in Steinhöfel zelebrieren, kollidiert frontal mit der parteipolitischen Doktrin, die von den fernen Zentralen diktiert wird. Und genau dort, in den Landes- und Bundesverbänden, löste die Nachricht eine Welle der Empörung und des Schocks aus, die binnen Stunden zu drakonischen Konsequenzen führte: Beiden Lokalpolitikern droht nun ein sofortiges Parteiausschlussverfahren.
Das Diktat der Parteizentralen: Ideologie schlägt Pragmatismus
Die Reaktionen der Mutterparteien sind ein Lehrstück über die Prioritäten der heutigen Parteiendemokratie: Ideologische Reinheit steht über dem konkreten Nutzen für die Bürger.
Aus den Reihen der AfD kam der Konterschlag schnell und scharf. Rainer Galla, Bundestagsabgeordneter und Kreisvorsitzender der AfD in der Region, reagierte mit humorloser Härte auf die „Provinzposse“. Galla stellte unmissverständlich klar, dass er „jede Form der Zusammenarbeit mit der Linken ablehne, egal auf welcher politischen Ebene“.
Seine Begründung ist ein Blick in den historischen Abgrund: Er bezeichnete Die Linke als die „Nachfolgerorganisation der SED“, die an der Demarkationslinie „auf die eigenen deutschen Bürger schießen ließ“. Zudem sei sie ein „sicherer Hafen für linke Extremisten“, die mit brutaler Gewalt gegen Andersdenkende vorgingen. Für ihn ist die Kooperation ein Verrat an den Grundsätzen der AfD und an den Wählern. Die Forderung an Matthias Natusch war ultimativ: Entweder er verlässt die neu gegründete Fraktion oder er verlässt sofort die Partei. Galla kündigte umgehend an, ein Parteiausschlussverfahren zu prüfen und notfalls in die Wege zu leiten.
Was diese Haltung jedoch so brisant und in den Augen vieler Beobachter heuchlerisch macht, ist die eigene jüngere Geschichte der AfD. Das Video über den Vorfall in Steinhöfel erinnert sehr deutlich daran, dass die Partei auf Bundesebene wiederholt versucht hat, gerade diese „Brandmauer“ zu unterlaufen oder zu durchbrechen. Es ist belegt, dass AfD-Vertreter, wie beispielsweise Stefan Brandner, nur wenige Monate zuvor öffentlich an Die Linke appelliert hatten, bei bestimmten Abstimmungen im Bundestag gemeinsam vorzugehen. Hier wurde ganz offen eine Kooperation gesucht, die man nun auf der kommunalen Ebene als Hochverrat brandmarkt. Es scheint, als sei die Brandmauer ein politisches Werkzeug: nützlich, wenn sie andere blockiert, aber abzureißen, wenn sie dem eigenen Vorteil dient. Dieses doppelte Spiel ist ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die sich nun für ihre kleine Gemeinde einsetzen.
Auch vonseiten der Linkspartei ließ die Reaktion nicht lange auf sich warten. Hier wird die Brandmauer traditionell als antifaschistisches Bollwerk verstanden, das unter keinen Umständen fallen darf. Stefan Wende, der stellvertretende Landesvorsitzende Brandenburgs, erklärte, dass Die Linke die Zusammenarbeit mit der als „gesichert rechtsextrem“ eingestuften AfD „entschieden ablehne“. Die Fraktionsbildung mit Matthias Natusch „verbietet sich von selbst“, so Wende.
Die Forderung an Bettina Lehmann ist identisch: Sie müsse die Fraktion „sofort wieder verlassen“ und sich einer „ehrlichen antifaschistischen, antirassistischen und sozialengagierten Kommunalpolitik“ widmen. Ein Weg, der nach Ansicht der Parteiführung nicht Hand in Hand mit der AfD gegangen werden kann. Sollte Lehmann dieser Forderung nicht nachkommen, droht auch ihr der Parteiausschluss – das Ende ihrer politischen Heimat für einen Akt der Vernunft.

Die Krise der Brandmauer-Politik
Der Fall Steinhöfel legt eine tieferliegende Malaise der deutschen Demokratie offen: die Tyrannei der Ideologie über den Pragmatismus.
Die Brandmauer, ursprünglich als Schutzwall gegen extremistische und antidemokratische Kräfte gedacht, hat sich im kommunalen Alltag in eine lähmende ideologische Sperre verwandelt. Auf der Bundesebene mag die strikte Ablehnung extremistischer Ränder politisch und moralisch begründet sein. Doch in einer kleinen Gemeinde, in der es um die Reparatur eines Schulweges oder die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr geht, erscheinen die Rigorismen der Parteizentralen wie ein groteskes und realitätsfernes Diktat.
Die beiden Kommunalpolitiker Lehmann und Natusch stehen stellvertretend für eine breite Sehnsucht in der Bevölkerung: die Sehnsucht nach lösungsorientierter Politik. Sie haben ihre Differenzen beiseitegeschoben, um gemeinsam Mehrheiten zu organisieren und Verwaltungsvorteile zu nutzen, die ihrer Gemeinde zugutekommen. Diese Form der überparteilichen Zusammenarbeit ist in anderen Ländern eine Selbstverständlichkeit, in Deutschland wird sie jedoch als Verrat geahndet, sobald sie die ungeschriebenen Gesetze der politischen Lagerbildung bricht.
Indem die Zentralen in Berlin und Potsdam nun mit der härtesten Waffe, dem Parteiausschluss, drohen, senden sie eine fatale Botschaft an ihre Basis: Es ist wichtiger, die parteiinterne Linie zu halten, als effektiv für die eigenen Wähler zu arbeiten. Wer in der Kommunalpolitik mit dem politischen Gegner zusammenarbeitet, um die Lebensqualität vor Ort zu verbessern, wird bestraft. Die Parteien zeigen damit, dass ihre Priorität nicht der ländliche Raum ist, sondern die Aufrechterhaltung der politischen Feindbilder, die ihre Existenz und ihre Machtposition definieren.
Die Brandmauer wird so nicht zu einem Schutz der Demokratie, sondern zu einem ideologischen Käfig, der innovative und bürgernahe Politik erstickt. Es ist ein Akt der politischen Selbstblockade, der die Parteien in den Augen vieler Bürger diskreditiert.

Ein Präzedenzfall mit fatalen Konsequenzen
Unabhängig vom Ausgang der nun drohenden Parteiausschlussverfahren hat der Steinhöfeler Pakt bereits jetzt historische Bedeutung. Er ist ein leuchtendes Beispiel dafür, dass die politischen Ränder in der Kommunalpolitik bereit sind, die zentralen Dogmen ihrer Parteien zu ignorieren, wenn sie einen Mehrwert für ihre Wähler sehen. Dies könnte ein Präzedenzfall sein, der eine Welle ähnlicher, pragmatischer Kooperationen in anderen Gemeinden auslösen könnte, in denen die herkömmlichen Mehrheitsverhältnisse bröckeln.
Sollten Lehmann und Natusch tatsächlich aus ihren Parteien ausgeschlossen werden, wäre dies eine tragische Konsequenz. Sie wären dann wohl fraktionslose Einzelkämpfer, die ihrer Gemeinde einen Bärendienst erwiesen hätten, weil sie sich zwar die „Vernunft“ zum Motto machten, aber das „Verantwortungsgefühl“ ihrer Parteioberen unterschätzten.
Doch selbst als parteilose Kommunalpolitiker wären sie lebende Symbole für den Graben zwischen der realitätsfernen Hochpolitik und dem praktischen Bürgerwillen vor Ort. Ihr Mut, die „künstlichen Grenzen“ zu überwinden, hat die politische Landschaft im Osten Deutschlands bereits unwiderruflich verändert. Die Brandmauer hat an Glaubwürdigkeit verloren; sie ist nicht länger eine unantastbare Doktrin, sondern nur noch eine politische Vereinbarung, deren Haltbarkeit von zwei entschlossenen Lokalpolitikern in einem kleinen Dorf auf die Probe gestellt wurde.
Der Ruf nach parteiinterner Disziplin ist laut, aber der Widerhall der Vernunft ist lauter. Steinhöfel ist nun der Ort, an dem sich entscheidet, ob deutsche Politik von ideologischer Reinheit oder vom konkreten Mandat der Bürger getragen wird. Die Augen der Nation blicken auf diese kleine Gemeinde in Brandenburg, in der zwei Politiker alles riskiert haben, um Brücken zu bauen, wo andere Brandmauern errichten. Es ist die emotional aufgeladene Geschichte eines Verrats, der sich wie der letzte Schrei nach lösungsorientierter Sacharbeit anfühlt. Die Zeit wird zeigen, ob die Brandstifter der Ideologie oder die Architekten der Vernunft obsiegen werden.