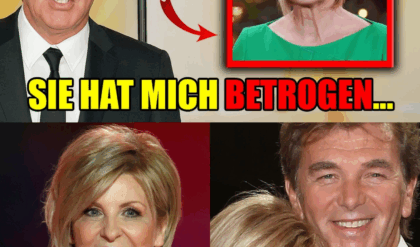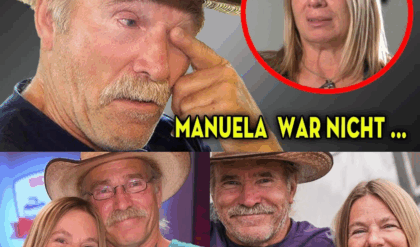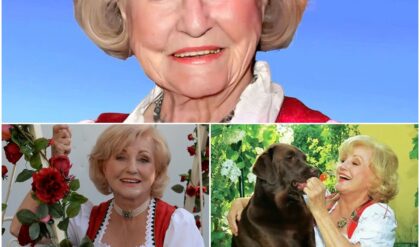Ein Raunen geht durch den Plenarsaal. Die Luft im Deutschen Bundestag ist oft spannungsgeladen, doch an diesem Tag knistert sie vor einer Energie, die weit über das übliche politische Geplänkel hinausgeht. Kameras sind auf das Rednerpult gerichtet, wo Alice Weidel, Co-Vorsitzende der AfD-Fraktion, zu einer Rede ansetzt, die nicht nur als politischer Angriff, sondern als fundamentale Abrechnung mit dem politischen Establishment in die Annalen eingehen wird. Es ist ein Moment, der die tiefe, klaffende Wunde in der deutschen Gesellschaft offenlegt – die Kluft zwischen denen “da oben” in Berlin und einem wachsenden Teil der Bevölkerung, der sich unverstanden, missachtet und verachtet fühlt.
In einer Rede, die von Wut und Empörung getragen wird, bricht Weidel ein Tabu. Sie greift nicht nur die Regierungsparteien oder die Opposition an. Sie zielt höher. Viel höher. Mit scharfer Stimme, die kaum einen Zweifel an ihrer Entrüstung lässt, schleudert sie Sätze in den Saal, die wie Peitschenhiebe wirken. “Der Bundespräsident,” so donnert Weidel, “bezeichnet AfD-Wähler als Ratten!” Der Vorwurf hängt schwer in der Luft. Der Bundespräsident, das nominell höchste Amt im Staat, der Mann, der überparteilich agieren und das gesamte Volk repräsentieren soll – ein Verächter eines Teils ebenjenes Volkes?

Doch Weidel legt nach. Es sei nicht nur das Staatsoberhaupt. Sie zitiert eine FDP-Spitzenkandidatin, die AfD-Wähler als “Schmeißfliegen” bezeichnet haben soll. Ratten. Schmeißfliegen. Es sind keine zufällig gewählten Beleidigungen. Es sind Begriffe aus dem Vokabular der Dehumanisierung. Es ist die Sprache der Schädlingsbekämpfung, die impliziert, dass es sich bei den so Bezeichneten nicht mehr um politische Gegner, nicht einmal mehr um Menschen mit einer anderen Meinung, sondern um Ungeziefer handelt, das man bekämpfen und ausmerzen muss.
“Schämen Sie sich!”, ruft Weidel den anderen Fraktionen entgegen, ihre Stimme überschlägt sich fast vor Zorn. “Schämen Sie sich den Grund um Boden!” Ob diese Zitate in ihrem Kontext korrekt wiedergegeben sind oder aus dem Zusammenhang gerissen wurden, spielt in diesem Moment fast keine Rolle mehr. Die Bombe ist geplatzt. Weidel hat das ausgesprochen, was ihre Anhänger und viele Wähler am rechten Rand des Spektrums seit Langem empfinden: dass die “Berliner Elite”, die “Altparteien”, sie nicht nur politisch bekämpfen, sondern sie fundamental verachten.
Diese Rede ist mehr als nur ein politisches Manöver; sie ist die Zuspitzung einer gefährlichen Dynamik. Sie nährt perfekt das Narrativ der AfD, die einzige Kraft zu sein, die “den Bürger” und “das Volk” gegen eine arrogante, abgehobene und globalistische Oberschicht verteidigt. Die Botschaft ist klar: Seht her, sie hassen euch. Sie halten euch für Ungeziefer. Nur wir stehen noch an eurer Seite.
Die Reaktion im Netz, befeuert durch Kanäle, die sich auf die Verbreitung solcher Inhalte spezialisiert haben, ist unmittelbar und gewaltig. Kommentatoren sprechen von “Gänsehaut”, von einem “unvergesslichen Moment” und einer “Abrechnung mit den Volksverrätern”. In den sozialen Medien wird der Clip millionenfach geteilt, er wird zur viralen Waffe im Kulturkampf. Jeder Klick, jedes “Share” ist eine Bestätigung der eigenen Weltsicht, ein Akt des Widerstands gegen die vermeintliche Verachtung aus Berlin. Die Wut von Millionen ehrlicher Bürger, wie es in einem Kommentar heißt, habe in Weidel ihre Stimme gefunden.
Was aber bedeutet dieser Eklat für die politische Kultur in Deutschland? Er offenbart eine besorgniserregende Eskalation der Sprache. Wenn der politische Diskurs derart vergiftet ist, dass Begriffe wie “Ratten” und “Schmeißfliegen” – selbst wenn sie “nur” als Vorwurf in einer Rede zitiert werden – im höchsten Parlament des Landes verhandelt werden, ist eine rote Linie überschritten. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, in der der politische Gegner nicht mehr als Konkurrent um die besten Ideen, sondern als Feind betrachtet wird, dessen Existenz eine Bedrohung darstellt.
Die von Weidel angegriffenen Parteien stehen vor einem Dilemma. Ignorieren sie die Vorwürfe, überlassen sie der AfD das Feld und das mächtige Narrativ der “Verachtung”. Reagieren sie darauf, müssen sie sich entweder für eine Sprache rechtfertigen, die (sollte sie so gefallen sein) indiskutabel ist, oder sie geraten in eine endlose Debatte über Zitate und Kontexte, bei der sie nur verlieren können. Denn in der emotional aufgeladenen Welt der sozialen Medien verfängt die einfache, brutale Botschaft (“Sie nennen euch Ratten!”) weitaus besser als jede differenzierte Erklärung.
Gleichzeitig muss die Frage gestellt werden, welche Verantwortung die AfD selbst an dieser Eskalation trägt. Kritiker der Partei werfen ihr seit Jahren vor, selbst mit Rhetorik zu operieren, die ausgrenzt, spaltet und Ressentiments schürt. Die Empörung über die Dehumanisierung des eigenen Wählerklientels wirkt auf viele Beobachter daher scheinheilig, wenn gleichzeitig aus den eigenen Reihen immer wieder gegen Minderheiten, Migranten oder politische Gegner gehetzt wird.

Doch in der Logik der Polarisierung ist die eigene Schuld stets ausgeblendet. Es herrscht ein ständiger Kampf um die Opferrolle. In Weidels Rede und der darauf folgenden Online-Begeisterung wird die AfD zur Märtyrerin stilisiert, zur verfolgten Opposition, die es wagt, die “Wahrheit” auszusprechen. Diese “Wahrheit” ist simpel: Die Altparteien, von der CDU unter Merz bis hin zur FDP und den linken Parteien, seien ein Einheitsbrei, eine “Elite”, die nur noch ihre eigene Ideologie durchsetze – sei es bei offenen Grenzen, der EU-Politik oder teuren Klimaprojekten.
Die Wut, die in Weidels Rede zum Ausdruck kommt, wird von ihren Anhängern direkt mit den realen Sorgen der Bevölkerung verknüpft. Warum fehlt das Geld für die Pflege? “Weil sie uns als Ratten betrachten, die keine Unterstützung verdienen”, heißt es in der Logik der AfD-Anhänger. Warum wird die Wirtschaft ruiniert? Weil die Elite in Berlin die “arbeitende Bevölkerung” verachtet. Diese Verknüpfung von politischem Versagen mit einer angeblichen moralischen Verkommenheit der Herrschenden ist ein hocheffektiver politischer Sprengstoff.
Der Frontalangriff auf den Bundespräsidenten ist dabei der strategisch wichtigste Teil der Rede. Das Amt des Bundespräsidenten soll wie ein symbolischer Anker über dem parteipolitischen Streit stehen. Indem Weidel ihm vorwirft, Teile des Volkes als “Ratten” zu diffamieren, reißt sie diesen Anker bewusst los. Sie signalisiert: Es gibt keine neutrale Instanz mehr. Der gesamte Staat, bis hinauf zu seinem höchsten Repräsentanten, ist gegen uns, gegen das “wahre” Volk, gerichtet. Es ist die totale Kriegserklärung an das “System”.
Die etablierten Parteien, oft als “Systemparteien” oder “Altparteien” geschmäht, scheinen dieser rohen, emotionalen Wucht wenig entgegensetzen zu können. Ihre oft komplexe, abwägende und technokratische Sprache erreicht die Menschen nicht mehr, die sich in ihrem Zorn bestätigt fühlen. Die Angst der Etablierten vor den Wahlen, vor dem Moment, in dem “das Volk ihnen die rote Karte zeigt”, wird von der AfD genüsslich ausgeschlachtet. Die einzige Waffe, die den Altparteien angeblich noch bleibt, seien “Lügen und Beleidigungen”.
Der “Ratten”-Eklat im Bundestag ist somit weit mehr als ein kurzfristiger Skandal. Er ist ein Symptom für eine tiefe Zerrissenheit. Er zeigt ein Land, in dem zwei Realitäten unversöhnlich aufeinanderprallen: die Realität derer, die das System als im Grunde stabil und schützenswert erachten, und die Realität derer, die es als feindselig, verachtend und korrupt ansehen.

Alice Weidels Rede war ein Brandbeschleuniger. Sie hat die Glut der Wut aufgenommen und in ein loderndes Feuer verwandelt. Sie hat ihren Anhängern die Bestätigung gegeben, nach der sie sich sehnten: Euer Gefühl, verachtet zu werden, ist real. Die höchsten im Staat hassen euch. Für einen Moment fiel die Maske der politischen Zivilisiertheit, und zum Vorschein kam, so die Botschaft, die “ganze Verachtung der Berliner Elite”. Dieser Moment, ob nun inszeniert oder authentisch, wird das politische Klima weiter vergiften und die Gräben in Deutschland noch tiefer machen. Die Frage, die nach diesem Tag im Raum steht, ist nicht mehr, ob eine Versöhnung möglich ist, sondern ob überhaupt noch jemand daran interessiert ist.