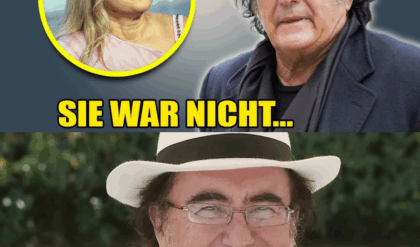Ein Gespenst geht um in Europa – und es trägt den Namen „Digitaler Euro“. Was von Politikern und Zentralbankern als nächster logischer Schritt in der Evolution des Geldes angepriesen wird, ein bequemes und modernes Zahlungsmittel, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein trojanisches Pferd. Es ist ein Instrument, das laut Experten wie dem Publizisten Dominik Kettner das Potenzial hat, nicht weniger als „die größte Enteignung der Geschichte“ einzuläuten. In einem eindringlichen Gespräch legt Kettner dar, warum es bei dieser neuen Währungsform nicht um Bequemlichkeit, sondern um totale Kontrolle, den Entzug von Freiheit und die schleichende Abschaffung unseres Privateigentums geht.
Die Zeit drängt. Bereits im Oktober 2025, so die Prognose, könnten die entscheidenden Gesetze verabschiedet sein, die den digitalen Euro auf den Weg bringen. Die Einführung, da ist sich Kettner sicher, wird nicht über Nacht geschehen. Sie folgt einer altbewährten Taktik: „Wie der Frosch im kochenden Wasser“, beschreibt er es. Die Temperatur wird langsam erhöht, Scheibchen für Scheibchen, bis es zu spät ist, um aus dem Topf zu springen. Die Bürger sollen sich graduell an die neuen Mechanismen gewöhnen, bis der finale Zustand der totalen Durchleuchtung und Kontrolle als Normalität akzeptiert wird.

Der digitale Euro als gesetzliches Zwangsmittel
Eine der alarmierendsten Entwicklungen, die Kettner in den Gesetzesentwürfen aufdeckt, ist Artikel 7. Dieser Paragraph soll dem digitalen Euro den Status eines „gesetzlichen Zahlungsmittels“ verleihen. Das klingt harmlos, hat aber massive Konsequenzen. Es bedeutet eine Annahmepflicht. Jeder Händler, jeder Gewerbetreibende, vom kleinen Bäcker bis zur großen Supermarktkette, wäre gezwungen, den digitalen Euro zu akzeptieren.
Dies ist ein direkter Angriff auf das letzte freiheitliche Zahlungsmittel, das wir besitzen: das Bargeld. Kettner berichtet von einer persönlichen Erfahrung, die ihn zum Schreiben seines Buches motivierte. In einem Spielwarengeschäft wollte er für seinen Sohn ein Boot kaufen, doch der Laden akzeptierte kein Bargeld mehr. „Nur noch Kartenzahlung“, hieß es. Der enttäuschte Blick seines Sohnes, dem er erklären musste, warum sie das ersehnte Spielzeug nicht mitnehmen konnten, wurde für ihn zum Symbol für einen größeren Kampf.
Dieser Trend, der seit Jahren die Abschaffung von Geldautomaten und die Zurückdrängung von Barzahlungen vorantreibt, ist kein Zufall. Er bereitet das Feld für eine Alternative, die angeblich alle Vorteile des Bargelds bietet, aber keine seiner „Nachteile“ – sprich: keine Anonymität. Man verspricht uns eine Offline-Funktion, eine digitale Geldbörse auf dem Smartphone, mit der wir auch ohne Internetverbindung zahlen können. Ein perfektes Substitut für den Geldschein in der Tasche. Doch dieser Ersatz hat einen verheerenden Preis: Er ist durchleuchtbar und kontrollierbar.
Die drei Säulen der totalen Kontrolle
Die wahre Gefahr des digitalen Euro, so Kettner, entfaltet sich erst im Zusammenspiel mit zwei weiteren Puzzleteilen, die derzeit mit Hochdruck vorangetrieben werden.
Das erste Teil ist der digitale Euro (CBDC) selbst, das programmierbare Geld.
Das zweite Teil ist die digitale ID (eID). Diese soll nach Plänen des Digitalministers Carsten Wildberger ab 2026 eingeführt und bis zum Ende der Dekade für jeden EU-Bürger verpflichtend werden. Diese ID ist weit mehr als ein digitaler Personalausweis. Sie soll eine zentrale Datenbank bilden, die alles über uns speichert: Ausweisdaten, Führerschein, Gesundheitsakten, polizeiliche Führungszeugnisse und potenziell sogar unsere Spuren im Internet. Ein gläserner Bürger in Reinform.
Das dritte und entscheidende Teil ist die AMLA (Anti-Money Laundering Authority). Diese neue EU-Superbehörde mit Sitz in Frankfurt soll offiziell die Geldwäsche bekämpfen. In Wahrheit, so die Befürchtung, wird sie zur zentralen Instanz, die alle Zahlungsströme in Echtzeit überwacht und durchleuchtet.
Das perfide Detail: Die Gesetzesentwürfe zum digitalen Euro sehen die „Interoperabilität“, also die direkte Verknüpfbarkeit von digitalem Geld und digitaler ID, bereits vor. Wenn diese drei Säulen – Geld, Identität und Überwachung – miteinander verbunden sind, entsteht das perfekte Kontrollinstrument.

Die Schreckensszenarien: Programmierbares Geld
Was bedeutet das konkret für den Einzelnen? Dominik Kettner skizziert Szenarien, die an dystopische Romane erinnern, aber technisch bereits möglich und in den Gesetzen angelegt sind.
Ein zentraler Punkt ist Artikel 24, der „bedingte Zahlungsvorgänge“ regelt. Das bedeutet, der Staat oder die Zentralbank kann Transaktionen an Bedingungen knüpfen. Sie könnten entscheiden, dass Sie bestimmten Personengruppen kein Geld mehr überweisen dürfen oder nur bis zu einer gewissen Höhe.
Noch beängstigender ist die Programmierbarkeit des Geldes. Man könnte Ihr Geld mit einem Verfallsdatum versehen. Stellen Sie sich vor, Sie erhalten Ihr Gehalt, und die Regierung beschließt, dass 10% davon bis zum Monatsende ausgegeben werden müssen, andernfalls verfällt es. Offiziell, um „die Konjunktur anzukurbeln“. Inoffiziell ist es eine Enteignung Ihrer Sparleistung.
Oder denken Sie an CO2-Budgets. Ihr digitaler Euro könnte direkt an Ihren persönlichen CO2-Verbrauch gekoppelt werden. Haben Sie diesen Monat bereits zu viel Fleisch gekauft oder Ihr Auto getankt? Pech gehabt, die digitale Geldbörse blockiert den nächsten Kauf an der Tankstelle.
Selbst soziales Wohlverhalten könnte zur Währung werden. Kettner malt das Bild eines Bürgers, der nicht in den Flieger steigen darf, weil sein „soziales Verhalten“ – vielleicht kritische Kommentare in sozialen Medien – dazu geführt hat, dass die Verfügbarkeit seines digitalen Euros eingeschränkt wurde.
Obergrenzen und personalisierte Inflation
Als wäre das nicht genug, wird offen über eine Obergrenze von etwa 3.000 Euro für den digitalen Euro diskutiert. Warum so niedrig? Kettner äußert einen düsteren Verdacht: „Vielleicht wirst du nach einer Bankenkrise dankbar sein, wenn da noch 3.000 Euro drauf sind.“ Es könnte ein Mittel sein, um im Krisenfall die Verluste der Banken auf die Bürger abzuwälzen und den Menschen nur einen winzigen, kontrollierbaren Rest ihres Vermögens zu lassen.
Gleichzeitig soll der digitale Euro unverzinst bleiben. Das ist die offizielle Enteignung durch Inflation. Doch die Möglichkeiten gehen noch weiter. Kettner spekuliert über eine personalisierte Inflation: „Der Dominik hat mal wieder ein böses Video gemacht, der kriegt mal 12% Inflation. Der Oli war auch böse, kriegt 10%.“ Wer der Regierungslinie folgt, bekommt 0%. Technisch wäre das ein Kinderspiel.
Es droht sogar ein Zweiklassengeld. Die Schweiz, so Kettner, arbeitet bereits an einer „Wholesale“ CBDC für Banken und Industrie und einer „Retail“ CBDC für die Bürger. Die Eliten bekämen andere Bedingungen als die breite Masse.
Ein globales Projekt ohne Ausweg
Wer nun glaubt, er könne diesem System entfliehen, indem er in die USA auswandert oder auf den Dollar setzt, irrt gewaltig. Kettner stellt klar, dass dies ein globales Projekt ist, koordiniert von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), der Zentralbank der Zentralbanken.

Selbst die Hoffnung auf Donald Trump sei trügerisch. Trumps Versprechen, „keine CBDC“ in den USA einzuführen, sei ein reines Ablenkungsmanöver. Stattdessen setze man dort auf sogenannte Stable Coins. Das sei im Grunde dasselbe: programmierbares, sanktionierbares und kontrollierbares Geld, das auf einer Blockchain läuft – nur dass es nicht direkt von der Zentralbank, sondern von privatwirtschaftlichen Unternehmen wie BlackRock herausgegeben wird. „Es ist im Endeffekt nichts anderes als ein Abbild des digitalen Euro“, so Kettner. „Am Ende dieselbe Geschichte.“ Eine Flucht ist nicht möglich.
Wie reagiert die Bevölkerung?
Die Architekten dieses Systems bauen auf die Akzeptanz der Masse. Eine eineinhalb Jahre alte Bundesbankumfrage scheint ihnen recht zu geben: 51% der Befragten würden den digitalen Euro einfach so akzeptieren. Etwa 20% waren unschlüssig. Nur rund ein Drittel lehnte ihn strikt ab. Kettner sieht hier Parallelen zur Pandemie – eine gespaltene Gesellschaft, in der eine Mehrheit den offiziellen Narrativen folgt.
Genau deshalb sei Aufklärung jetzt das oberste Gebot. „Wir müssen möglichst viele Menschen damit abholen, um die Akzeptanz zu bremsen“, appelliert Kettner. Es gehe nicht um irgendein Geld, es gehe um ein Kontrollinstrument.
Gibt es überhaupt noch Lösungen?
Trotz der düsteren Aussichten predigt Kettner nicht die Hoffnungslosigkeit, sondern die Eigenverantwortung. Sein Buch soll ein ganzheitlicher Ratgeber sein, der über die üblichen Tipps wie „kauf Gold“ hinausgeht.
Er rät zu einem mehrstufigen Notfallsystem. Das beginnt bei der analogen Krisenvorsorge, einem „Prepper Guide“ für jedermann: Vorräte an Nahrung, Wasser, Medizin, aber auch autarke Energie- und Wärmequellen wie Balkonkraftwerke oder Teelichtöfen. Essentiell seien auch analoge Dokumentenordner, Bargeldreserven und Spritkanister.
Ein weiterer Baustein sei die „Unersetzbarkeit“. Damit meint er das Wiedererlernen von handwerklichen Fähigkeiten, Landwirtschaft, Reparaturwissen – alles, was in einer Krise Tauschwert besitzt.
Natürlich gehören auch Sachwerte dazu. Gold und Silber, vor allem in kleinen Stückelungen, um als Tauschmittel abseits des zentralen Systems fungieren zu können. Aber auch Kryptowährungen, Auslandsimmobilien oder strategisch aufgestellte Holdingkonzepte.
Nicht zuletzt sei die digitale Selbstverteidigung entscheidend: die Nutzung sicherer Messenger, die Abschirmung von Smartphones in sogenannten Faraday-Taschen, um nicht permanent abgehört zu werden.
Der Weg in die Freiheit, so das Fazit, führt über die Unabhängigkeit und die Aufklärung. Es sei die „letzte Eisenbahn“. Wer jetzt nicht handle, während das Wasser bereits von 44 auf 90 Grad erhitzt wird, sei selbst schuld. Der Weckruf von Kettner, unterstützt von prominenten Namen wie Robert Kiyosaki und Peter Hahne, ist unmissverständlich: Lesen, verstehen und handeln – bevor es zu spät ist.