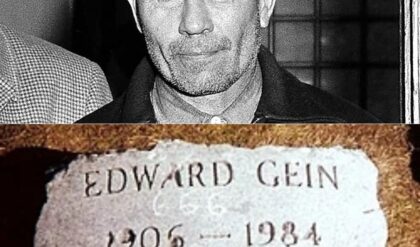Kerstin Ott – ein Name, der uns allen sofort diesen einen Song ins Gedächtnis ruft: „Die immer lacht“. Millionen haben mitgesungen, mitgeweint, mitgefühlt. Es war die Hymne an all jene, die ihre Fassade so festgeklebt haben, dass sie fast daran erstickt wären. Doch während wir ihre Lieder im Radio lauthals mittrellerten und ihre Stärke auf der Bühne feierten, schwieg sie selbst jahrelang. Jetzt, mit 43 Jahren, hat Kerstin Ott endlich den Mut gefunden, das zu sagen, was sie so lange für sich behalten hat. Es ist eine Geschichte, die nicht nur ihr Leben, sondern auch das Bild, das wir alle von ihr hatten, für immer erschüttern wird. Eine Geschichte von inneren Kämpfen, dem Druck des Ruhms, einem ergreifenden Abschied und der Suche nach der eigenen, wahren Identität in einer Welt voller Erwartungen und Schubladen.
Geboren 1982 in Westberlin, mitten in einer Zeit, in der Anderssein selten Applaus bekam, war Kerstin schon als Kind ein kleines Rätsel. Laut, wild, unangepasst – Eigenschaften, die man einem Mädchen gern austreiben wollte. Während andere in der Schule Pferdeposter sammelten, spielte Kerstin lieber Gitarre und trug Klamotten, die keiner Modezeitschrift entsprangen. Viele sahen nur die Rebellin, kaum einer das verletzliche Mädchen dahinter. Schon früh spürte sie: „Irgendwas an mir passt nicht in dieses Bild, das alle sehen wollen.“ Diese innere Zerrissenheit sollte sie über Jahrzehnte begleiten.

Mit 17 kam der Moment, den sie in Interviews heute nur mit einem Kopfschütteln beschreibt: der erste echte Kuss. Aber nicht mit einem Jungen. Für sie war das wie ein Befreiungsschlag und gleichzeitig der Beginn eines stillen Kampfes. Stell dir vor, du weißt endlich, wer du bist, aber du darfst es nicht zeigen. Weil Freunde dich fallen lassen könnten. Weil die Familie, die dir Sicherheit geben sollte, plötzlich mit dem Finger auf dich zeigt. Kerstin hat sich damals eine dicke Mauer gebaut – außen taff, innen voller Fragen. Man hört diese Mauer in ihren Liedern, zwischen den Zeilen, dieses raue, ehrliche, unperfekte. Und ich glaube, genau deshalb lieben die Menschen sie so sehr. Sie spielt keine perfekte Popfigur. Sie bleibt Kerstin, die Frau, die beim Singen ihre Angst weglacht. Doch hinter jedem Lachen lag eben auch das jahrelange Schweigen.
Ihre musikalischen Anfänge waren weit entfernt vom Glanz der großen Bühnen. Sie begann in einem kleinen, chaotischen Zimmer, irgendwo zwischen Berliner Plattenbau, kaputten Heizkörpern und einer Mutter, die zu sehr mit ihren eigenen Schatten beschäftigt war, um der Tochter Halt zu geben. Genau dort, zwischen verkratzter Gitarre und alten Schallplatten, schrieb Kerstin ihre ersten Zeilen. Keine Chart-Hits, keine Lieder für den Ruhm, sondern Rettungsringe. Jeder Akkord, jedes Wort war ein leiser Aufschrei: „Seht mich, hört mich, versteht mich.“ Man kann sich das heute kaum vorstellen, wenn man sie auf großen Bühnen sieht – diese selbstbewusste Kerstin, die mit „Die immer lacht“ ganz Deutschland einen Spiegel vorhält. Doch wer genau hinhört, spürt zwischen den Tönen noch immer das Kind, das sich im grauen Berlin des Winters 1994 in sein kleines musikalisches Paralleluniversum flüchtete. Während draußen der Mief der Hauptstadt an den Fenstern klebte, nahm Kerstin heimlich ihre ersten Demos auf. Leise, fast flüsternd, damit kein Nachbar klopft. Ein altes Kassettenrekorder-Mikro war ihr Studio, ein Schuhkarton unter dem Bett ihr Tresor. Darin liegt ihre Kraft: nicht die perfekt gestylte Fassade, sondern dieser Mut, die eigenen Risse nicht zu verstecken.
In der Schule war sie nicht die mit den Pferdepostern. Sie war die mit der großen Klappe, dem ironischen Grinsen, den aufgerissenen Knien und dem spöttischen Blick, der jeden Lehrer provozierte. Natürlich war das eine Mauer, ein Schutzwall gegen Blicke, die sie immer wieder fragten: „Was bist du eigentlich?“ Ihre erste Bühne war keine Arena, sondern ein muffiger Schulflur, ein Schulfest, bei dem sie eigentlich nur einspringen sollte. Zitternde Hände, verschwitzte Stirn, ein Song, der mehr über sie verriet als jedes Zeugnis. Und dann Stille. Keine Hänseleien, kein Spott, nur dieser eine Blick. Ein Lehrer, der zum ersten Mal nickte, als wollte er sagen: „Da steckt mehr in dir, als du selbst glaubst.“
Kerstin Ott hat nicht gesiegt, weil sie in den Charts gelandet ist. Sie hat gesiegt, weil sie sich selbst erlaubt hat, überhaupt gehört zu werden. Es war nicht Berlin, das sie gerettet hat, nicht Hamburg, nicht der große Plattenvertrag. Es war diese zerschrammte Gitarre, die alte Kassette, die kleinen Dorfhochzeiten, bei denen sie als DJ auflegte, während andere sich das Jawort gaben. In Heide, einem Kaff im Norden, keine große Bühne, keine Blitzlichter. Tagsüber Malermeisterin, abends Platte auflegen auf Dorffesten. Manche hätten gesagt: verschenktes Talent. Doch genau da lag ihre Freiheit. Keine Schublade, kein Etikett. Einfach Kerstin, mit Ecken, Kanten, Geschichten, die erst Jahre später ganz Deutschland mitsingen würde. Und genau deshalb glaube ich, dass ihre Musik uns auch noch in Jahren berühren wird – weil sie echt ist, weil sie uns zeigt, dass selbst die stillsten Schreie irgendwann ein Mikrofon finden.
Kerstin Ott hat nie darum gebeten, eine Ikone zu sein. Ganz sicher nicht. Sie wollte einfach nur ihre Songs spielen, Lieder, die sie in ihrem Zimmer geschrieben hat, mit einer Gitarre auf dem Schoß und einer Wahrheit im Herzen, die zu groß war, um sie zu verschweigen. Und doch saß sie eines Abends auf ihrer Couch, Carolina neben sich, als „Die immer lacht“ plötzlich im Fernsehen lief, mitten im Primetime-Programm, quer durchs Land. Kerstin starrte auf den Bildschirm, als sähe sie eine andere Version von sich selbst. „Das bin ich“, murmelte sie, nicht stolz, sondern fast ungläubig. Vielleicht, weil sie genau wusste, wie viele Jahre sie gebraucht hatte, um diese drei Worte laut auszusprechen: „Das bin ich.“ Was so viele nicht sehen. Dieser Song, der später Millionen auf Festivals zusammenbrüllen würden, war nie als Party-Hit gedacht. Es war ihr Bekenntnis, eine kleine Hymne an all die, die ihr Lachen wie ein Schutzschild vor sich hertragen, während sie innerlich leise zerbrechen.

Diese Frau hat uns nie eine perfekte Welt vorgespielt. Sie hat gezeigt, dass Stärke manchmal bedeutet, genau dann weiterzumachen, wenn man eigentlich längst aufgeben wollte. Und Carolina – sie war nie nur die Frau an Kerstins Seite, sie war der Grund, warum diese Songs überhaupt das Licht der Welt erblickt haben. Während andere Kerstin in Schubladen stecken wollten – lesbische Sängerin, Coming-Out-Star – war Carolina die, die leise sagte: „Du bist mehr, deine Lieder sind mehr.“ Keine große Bühne, keine Marketingmaschinerie hätte jemals ersetzen können, was diese eine Begegnung bewirkt hat. Kerstins Geschichte zeigt, dass es nicht immer die lauten Küsse, die roten Teppiche oder die Blitzlichter sind, die ein Leben verändern. Manchmal ist es ein Satz bei Nacht im Auto: „Wenn du sprichst, wird es still in mir.“ Ein Satz, der später Tausenden Mut machte.
Ihre Beziehung war nie ein Hollywood-Märchen mit Feuerwerk und Rosenregen. Sie war echt, langsam gewachsen, auf Vertrauen, Angst, Neuanfang. Aber mit dem Erfolg kam auch der Preis. Plötzlich wollten alle wissen: Wie ist sie privat? Ist sie politisch? Was sagt sie zu Queer-Debatten? Und Kerstin saß in Talkshows, schaute in Kameras, atmete durch: „Ich bin mehr als mein Outing“, sagte sie, und sie hatte recht. Wer ihre Songs hört, hört nicht nur eine Schlagzeile, man hört ein ganzes Leben. Die Unsicherheit, das Kind in Berlin, das sich nicht einordnen ließ, die DJane aus Heide, die Hochzeiten musikalisch rettete, wenn der Bräutigam zu nervös war. Die Frau, die mit Carolina zwei Kinder großzieht und in jedem Interview lieber über echte Gefühle spricht als über Etiketten. Kerstin hat nie darum gebeten, perfekt zu sein, und genau deshalb hören wir ihr zu – weil sie mit jedem Ton sagt: „Ich bin nicht immer stark, ich bin nicht immer mutig, aber ich bin immer ich.“
An diesem grauen Oktobermorgen 2025 saß Kerstin Ott einfach da. Keine Schminke, kein Filter, nur sie. In diesem Video, das sie selbst hochgeladen hat, sagte sie Sätze, die mich ehrlicher gesagt mehr berührt haben als jede noch so glänzende Chartplatzierung. Sie sprach nicht von Goldplatten, nicht von ausverkauften Hallen, sondern davon, was es bedeutet, sich selbst nicht zu verlieren, während alle Welt dich zum Symbol macht. „Ich kann nicht mehr so tun, als wäre ich immer stark“, sagte sie mit rauer Stimme, während Regen gegen das Fenster trommelte. „Ich wollte nie ein Vorbild sein, aber wenn ich es schon bin, dann wenigstens ein echtes.“ Genau das macht Kerstin Ott so besonders. Sie war nie der Popstar, der sich biegt, bis er passt. Sie hat sich nie in Glitzer gezwängt, nur um den Applaus noch ein bisschen länger festzuhalten. Stattdessen sagt sie jetzt: „Schaut her, ich bin immer noch die, die ich war, und ich habe Fehler und ich habe Angst, aber ich mache weiter.“
Was viele nicht wissen: Hinter diesem Geständnis steckt mehr als nur ein paar medienwirksame Tränen. Hinter den Kulissen kämpfte Kerstin jahrelang mit dem Druck, immer zu liefern, immer noch einen Hit rauszuhauen, immer „die immer lacht“ zu sein. Doch privat war da dieser Spagat zwischen Sichtbarkeit und Schutz. Die Kinder von Carolina, ihre kleine Familie – alles wurde plötzlich öffentlich kommentiert. Fragen wie Dolche: „Warum habt ihr keine eigenen Kinder? Warum sehen wir euch nicht öfter zusammen auf dem roten Teppich?“ Kerstin schwieg nicht aus Scham, sondern weil sie sich weigerte, ihre Liebe zum Thema zu machen, das andere vermarkten wollten. Dieser Moment jetzt ist mutiger als jeder Coming-Out-Titel in einer Klatschzeitung, weil er zeigt, dass Erfolg nicht bedeutet, dass die Zweifel verschwinden. Kerstin saß da in diesem Video, sprach über ihre Ängste, ihre Therapiesitzungen, ihre Depressionen, die Nächte, in denen sie Carolina fragte: „Warum hören die Menschen mir eigentlich noch zu?“
Und während draußen der Herbstregen prasselte, sagte sie einen Satz, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht: „Ich habe gelernt, dass ich niemandem mehr beweisen muss, dass ich stark bin. Ich will nur beweisen, dass ich echt bin.“ Vielleicht war es genau das, was viele von ihr hören wollten. Keine perfekte Pose, keine Parole, sondern die Stimme einer Frau, die selbst nie daran geglaubt hat, dass man so weit kommen kann, wenn man einfach nur man selbst bleibt. In diesem Video versprach sie keine Welttournee, keine neue Imagekampagne. Sie versprach nur eines: dass sie weitermacht, auf ihre Art, mit Jeans, Kapuzenpulli, rauer Stimme und Texten, die manchmal wehtun, weil sie so wahr sind.

Diese Szene: Kerstin, 43 Jahre alt, sitzt in ihrer kleinen Altbauwohnung mit Blick auf den Hamburger Hafen. Neben ihr Leon. Ein Mann, der eigentlich nie Teil ihres Lebensplans war und doch ist er jetzt da. Vielleicht ist genau das die Kerstin, die wir so oft auf Bühnen gefeiert haben – die Frau, die immer wieder zeigt, dass das Leben keine Schablone kennt. Als sie in diesem ehrlichen Video sagte: „Ich will ehrlich mit euch sein“, das spürte man sofort. Das ist kein PR-Move, kein kalkulierter Skandal, sondern ein Mensch, der sich selbst laut ausspricht. Viele nennen es zweites Coming-Out. Ich finde, es ist eher ein Hineingehen – ein Hineingehen in eine neue Version ihrer selbst. Kerstin hat nie in klare Kategorien gepasst, weder musikalisch noch privat. Sie hat mit „Die immer lacht“ eine Hymne geschrieben für all jene, die ihre Fassade so festgeklebt haben, dass sie fast daran erstickt wären. Und jetzt klebt sie ihre eigene Fassade Stück für Stück ab. Dass sie sich in Leon verliebt hat, wirkt auf manche wie ein Bruch, auf mich wie eine Fortsetzung. Sie liebt keinen Stempel, keine Schublade, sondern Menschen.
Wer Kerstin ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass ihre größte Stärke immer ihre Widersprüche waren. Wie viele hätten sich einfach weiter in dieser perfekten Rolle als lesbische Vorzeigekünstlerin ausgeruht? Doch Kerstin war nie eine Fahne, die andere im Wind schwenken konnten. Sie war immer ihre eigene Melodie – mal schräg, mal laut, mal brüchig. Klar, die Netzkommentare tun weh. Manche Fans fühlten sich verraten: „War das alles nur eine Phase? Wo bleibt dein Platz in der Community?“ Aber ganz ehrlich, wer so fragt, hat nie wirklich zugehört. Kerstin wollte nie Symbol sein. Sie wollte nie die Eine, die alles richtig macht. Sie wollte nur singen, erzählen, Menschen berühren. Das tut sie jetzt, nur eben mit einer Geschichte, die brisanter, unvorhersehbarer, echter ist als jede glattgebügelte Popmär.
Leon wirkt dabei fast wie ein Gegenentwurf zum Rummel. Kein Manager, kein Influencer, ein Barkeeper aus Hamburg, der Kerstin offenbar daran erinnert hat, dass Liebe nicht plant, sondern passiert. Das allein zeigt, wie sehr Kerstin sich selbst treu bleibt. Keine perfekte Love-Story aus dem Hochglanzmagazin, sondern eine Begegnung an einer Bar. Zwei Menschen, ein ehrliches Gespräch. Mehr braucht es manchmal nicht, um ein Leben umzuschmeißen. Was ich an Kerstin bewundere, ist ihre Unerschrockenheit. Nach all den Jahren Bühne, Interviews, Preis-Shows sitzt sie jetzt da, wieder verletzlich, wieder unsicher, und doch stärker als je zuvor. Das neue Album „Zwischentöne“ klingt, als hätte sie in jede Zeile das Chaos gepackt, das in ihr brodelt. Keine Hitsingle, die sofort Stadionchöre füttert, sondern Texte, die schmerzen, die fragen: Wer bin ich für dich? Wer bin ich für mich? Und vielleicht liegt genau da ihre Relevanz: nicht in Chartrekorden, sondern darin, dass sie uns zeigt, wie man sich immer wieder neu erfindet, ohne sich zu verraten. Kerstin ist kein Denkmal. Sie ist eine, die weitergeht, auch wenn der Weg holprig ist. Und wer weiß, wohin sie uns noch mitnimmt? Eines ist klar: Wer echte Musik sucht, wird sie bei ihr immer finden. Irgendwo zwischen Hafenblick, Hoodie und einer Stimme, die sagt: „Ich bin nicht fertig, ich fange gerade erst wieder an.“