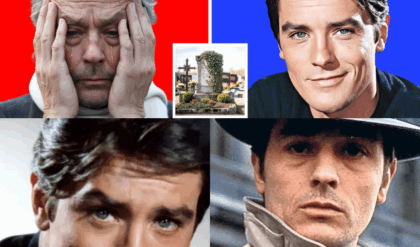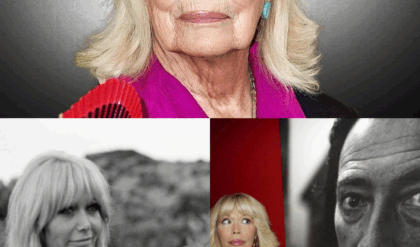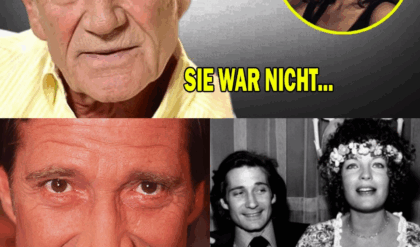Ein Berg aus Muskeln, gehüllt in ein viel zu enges Aldi-Nord-Poloshirt, stemmt eine Jury aus drei Personen in die Luft. Derselbe Mann macht Bizeps-Curls mit prall gefüllten Einkaufskörben. Er zieht eine ganze Palette, auf der eine ältere Dame sitzt, mit bloßen Händen durch den Gang. Er trägt zwei leere Paletten wie Schulterpolster. Und er mixt sich in der Kaffeekanne einen Thunfisch-Shake.
Was klingt wie ein Fiebertraum, ist die neue Werbekampagne von Aldi Nord. Der Protagonist: Markus Rühl, die vielleicht ikonischste und authentischste Legende des deutschen Bodybuildings. Das Ergebnis: ein viraler Flächenbrand.
Das Internet ist sich einig. Unter den Videos auf YouTube, Instagram und Facebook häufen sich Kommentare wie: „Das ist die beste Werbung, die ich je gesehen habe“ oder „Beste Werbung auf dieser Erde“. Der Discounter hat es geschafft, mit einem einzigen, genialen Schachzug die gesamte deutsche Medienlandschaft zu dominieren. Doch dieser Erfolg ist weit mehr als nur ein cleverer Marketing-Gag. Es ist ein kulturelles Statement. Es ist der kommerzielle Beweis für eine lange brodelnde gesellschaftliche Strömung, die oft als „Go Woke, Go Broke“ zusammengefasst wird. Aldi Nord und Markus Rühl haben nicht nur ein Produkt beworben – sie haben Männlichkeit als Marketing-Superwaffe reaktiviert.

Um den Erfolg zu verstehen, muss man die Kampagne in ihrer Gänze betrachten. Es ist nicht nur der absurd-komische Werbespot. Es ist die Authentizität, die Rühl mitbringt. Der Spot zelebriert seine berühmtesten Sprüche, allen voran „Muss nicht schmecke, muss wirke“ – ein Satz, der für eine ganze Generation von Fitness-Enthusiasten zum Mantra wurde. Rühl parodiert sich selbst, aber er verrät sich nicht. Er ist genau der, der er immer war: unverblümt, brachial und auf eine sympathische Art und Weise völlig übertrieben.
Der virale Erfolg blieb nicht digital. Als Teil der Kampagne setzte sich Rühl leibhaftig in einem Aldi-Markt in Essen an die Kasse, um die Einkäufe der Kunden abzurechnen. Das Ergebnis waren Hunderte von Menschen, die in einer gigantischen Schlange anstanden, nur um von “The German Beast” kassiert zu werden. Junge, trainierte Männer, Fans der ersten Stunde, aber auch schmunzelnde Rentner. Die Aktion war ein Volksfest. Sie bewies: Der Hype war echt und greifbar.
Doch warum explodiert diese Werbung im Jahr 2024 derart? Warum wird eine Zurschaustellung von Männlichkeit, die vor zehn Jahren vielleicht als „witzig“ oder „albern“ abgetan worden wäre, heute als revolutionär gefeiert?
Die Antwort, so Analysten, liegt in einem Vakuum. Sie liegt in der Ermüdung der Konsumenten. In den letzten Jahren hat sich in der westlichen Werbewelt ein Trend verfestigt, der oft als “Purpose Marketing” bezeichnet wird. Werbung soll nicht mehr nur verkaufen, sie soll erziehen. Sie soll gesellschaftliche Werte vermitteln, Haltung zeigen und oft genug auch politisch Stellung beziehen. Das Problem: Ein großer Teil der Gesellschaft fühlt sich davon nicht nur nicht angesprochen, sondern aktiv bevormundet.
Wie im Quellvideo argumentiert wird, ist in der öffentlichen Wahrnehmung, insbesondere in Deutschland, Männlichkeit selbst zu einem „Problem“ deklariert worden. Sie wurde oft mit Toxizität gleichgesetzt, kritisiert und dekonstruiert. Die Folge: Werbung wurde vorsichtiger, angepasster und, in den Augen vieler, blutleer.
In diese Lücke stößt nun Aldi. Die Rühl-Kampagne ist das genaue Gegenteil von belehrend. Sie ist purer Eskapismus. Sie politisiert nicht, sie unterhält. Sie entschuldigt sich nicht für das, was sie ist. Der Erfolg von Markus Rühl ist der Erfolg der Unerzogenheit. Es ist die kollektive Erleichterung von Millionen Menschen, die es satt haben, dass ihnen selbst beim Fußballspiel oder beim Kauf von Lebensmitteln eine politische Agenda präsentiert wird. Die Menschen, so die offensichtliche Schlussfolgerung, „lechzen“ förmlich nach dieser Art von unbeschwerter Normalität.
Dieser Trend ist kein deutsches Phänomen. In den USA löste die Werbung der Jeans-Marke “Great Jeans” mit der Schauspielerin Sydney Sweeney einen ähnlichen Effekt aus. Die Kampagne, die Sweeneys Weiblichkeit und Attraktivität feierte, wurde online von Kritikern angegriffen, führte aber laut Berichten dazu, dass die Aktie der Muttergesellschaft American Eagle durch die Decke ging. Die Botschaft ist dieselbe: Authentizität und das Bedienen der Kernzielgruppe schlägt die Angst vor einem “Online-Mob”.

Die Aldi-Kampagne wird auch deshalb so stark rezipiert, weil sie in eine Zeit fällt, in der die Gegenbeispiele – das sogenannte “Go Woke, Go Broke”-Phänomen – immer sichtbarer werden.
Das prominenteste deutsche Beispiel ist Rügenwalder Mühle. Das Traditionsunternehmen hat sich in den letzten Jahren aggressiv auf den veganen und vegetarischen Markt konzentriert. Eine strategische Entscheidung, die zunächst mutig erschien. Doch nun warnt das Unternehmen aus Bad Zwischenahn öffentlich vor „hohen Kosten und Umsatzeinbußen“. Gleichzeitig steht die Frage im Raum, ob pflanzliche Produkte überhaupt noch „Schnitzel“ oder „Wurst“ heißen dürfen.
Die Kritik an Rügenwalders Strategie, die im Netz laut wird, ist vielschichtig. Es ist nicht nur die Konzentration auf eine Nische, sondern die als unlogisch empfundene Namensgebung. Warum, so die Frage, muss ein veganes Produkt so heißen wie das, was es ersetzen will?. Es suggeriert eine Imitation statt einer eigenständigen Innovation und verwirrt womöglich die traditionelle Kernkundschaft, ohne die neue vollständig zu überzeugen.
Ein weiteres Beispiel ist der ikonische Motorradhersteller Harley Davidson. Das Unternehmen, dessen Name wie kein zweiter für Freiheit, Rebellion und pure Männlichkeit steht, hatte laut Berichten seine Diversitätsprogramme stark ausgebaut. Das Ziel war, neue Zielgruppen zu erschließen. Das Ergebnis war offenbar eine Entfremdung der Kernkundschaft. Potenzielle Kunden, die ein Motorrad als Ausdruck von Kraft und Konservatismus sahen, identifizierten sich nicht mehr mit der Marke. Mittlerweile hat das Unternehmen diese Programme laut Medienberichten wieder beendet – eine schmerzhafte, aber notwendige Rückbesinnung auf die eigene DNA.
Was Rügenwalder und Harley Davidson zu lernen scheinen, hat Aldi Nord instinktiv verstanden. Das Grundgesetz des Marketings, das in New Yorker Universitäten gelehrt wird, lautet: „Who is my target audience?“. Wer ist meine Zielgruppe?
Harley Davidson verkaufte an Männer, die Männlichkeit suchen. Rügenwalder verkaufte an Menschen, die Wurst mögen. Indem sie versuchten, allen zu gefallen, drohten sie, ihre treuesten Kunden zu verlieren.
Aldi Nord hingegen hat seine Zielgruppe perfekt verstanden. Sie wussten, dass ein großer Teil ihrer Kundschaft – und weit darüber hinaus – Markus Rühl kennt und schätzt. Sie wussten, dass diese Zielgruppe Humor, Authentizität und eine Pause von der allgegenwärtigen Politisierung zu schätzen weiß. Sie haben sich getraut, etwas zu tun, was heute als riskant gilt: Sie waren spezifisch. Sie waren laut. Und sie waren unapologetisch männlich.

Die Rühl-Revolution ist daher mehr als nur eine gelungene Werbung. Sie ist ein Weckruf für die gesamte Branche. Sie beweist, dass “Männlichkeit” kein Problem ist, das dekonstruiert werden muss, sondern ein mächtiges, positives und extrem profitables Marketinginstrument sein kann, wenn es mit Selbstironie und Authentizität eingesetzt wird.
Es zeigt, dass der Mut, die eigene Kernzielgruppe direkt und ohne Entschuldigungen anzusprechen, nicht nur zu Verkäufen führt, sondern zu etwas viel Wertvollerem: echter, viraler Begeisterung und kultureller Relevanz. Die Konkurrenz mag über Haltung und gesellschaftliche Verantwortung philosophieren – Aldi Nord verkauft währenddessen Paletten voller Produkte.
Die Botschaft von Markus Rühl, “Muss nicht schmecke, muss wirke”, galt eigentlich seinem Thunfisch-Shake. Heute ist sie zur perfekten Beschreibung für Aldis Marketing-Strategie geworden.