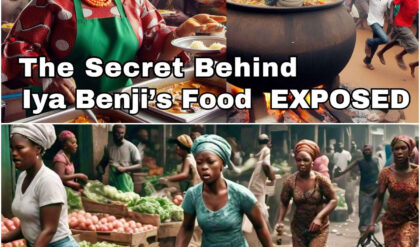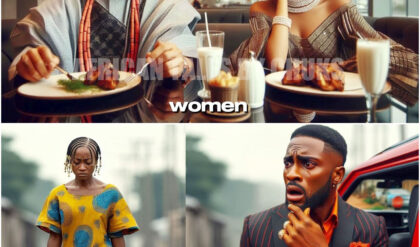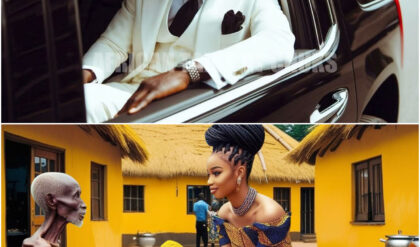Die deutsche Supermarktlandschaft wird derzeit Schauplatz einer ungewöhnlichen und politisch brisanten Auseinandersetzung, die weit über das Kühlregal hinausreicht. Im Zentrum steht ein Aufruf der Nichtregierungsorganisation (NGO) Campact, kostenlose Sticker mit AfD-Symbolen zu bestellen und diese auf Produkte der Firma Müller – insbesondere Müllermilch – in Supermärkten anzubringen. Die Aktion, die als „sanfte Grüße“ der AfD an die Konsumenten gedacht ist, zielt darauf ab, auf die vermeintliche Unterstützung eines Milliardärs für „rechtsextreme Salonfiguren“ hinzuweisen, wie Campact auf seiner Webseite erklärt. Doch was als kritischer Protest begann, hat sich durch einen geschickten Konter von Alice Weidel, der Co-Vorsitzenden der AfD, zu einem unerwarteten Schlagabtausch entwickelt, der sowohl juristische Fragen aufwirft als auch die Diskussion über Meinungsfreiheit und Boykottaktionen neu entfacht.
Campact fordert seine Unterstützer auf, ein „AfD Logo im Supermarkt mit unseren Aufklebern auf Müllermilch und Co“ anzubringen, um „direkt im Supermarkt aufzuklären, wer zu Müllerprodukten greift, unterstützt einen Milliardär, der rechtsextreme Salonfig machen will“. Die Organisation versichert auf ihrer Webseite, dass das Kleben von Stickern im Supermarkt erlaubt sei, „solange die Produkte nicht beschädigt werden“. Ein Beileger im Stickerpaket soll alle wesentlichen Informationen und Hinweise zur Aktion zusammenfassen. Für die Aktivisten ist es denkbar einfach: 24 Sticker bestellen, nach Hause liefern lassen und dann im Supermarkt loslegen.

Der geniale Konter von Alice Weidel
Die Brisanz der Aktion erreichte jedoch ein neues Level, als Alice Weidel höchstpersönlich zum Gegenschlag ausholte. In den sozialen Medien rief sie dazu auf, die Sticker von Campact „eifrig [zu] bestellen“, jedoch mit einer entscheidenden Einschränkung: „darauf achten erst nach dem Kauf aufkleben sonst wäre es ja Sachbeschädigung und bloß nicht über die Pfandmarke kleben sonst nimmt der Automat die Flasche nicht zurück“. Weidel verlinkte zudem die Aktion, womit sie das Framing von Campact aufgriff und geschickt umkehrte. Statt eines Boykottaufrufs wurde es zu einer fast schon ironischen Unterstützung, die die ursprüngliche Intention von Campact ad absurdum führte und die Aktivisten in eine schwierige Lage brachte. Die AfD-Vorsitzende demonstrierte damit erneut ihr Gespür für politische Kommunikation und ihre Fähigkeit, scheinbar negative Kampagnen zum eigenen Vorteil zu nutzen.
Dieser Schachzug Weidels, die scheinbar harmlosen Sticker in den Kontext eines möglichen Kaufs zu stellen, hat das Potenzial, die Kampagne von Campact zu unterlaufen und möglicherweise sogar eine ungewollte Werbewirkung für die Müller-Produkte bei AfD-Sympathisanten zu erzeugen. Es ist ein klassisches Beispiel für ein „Reverse-Framing“, bei dem die Botschaft des Gegners aufgegriffen und so umgedeutet wird, dass sie der eigenen Agenda dient.
Juristische Fallstricke und mögliche Folgen
Die Behauptung von Campact, das Anbringen von Stickern sei erlaubt, solange keine Beschädigung erfolgt, erweist sich bei näherer Betrachtung als juristisch fragwürdig. Selbst ohne Jurist zu sein, drängt sich die Frage auf, ob das Verändern fremden Eigentums, selbst wenn der Sticker rückstandslos entfernbar ist, nicht bereits eine Form der Sachbeschädigung darstellen könnte. Eine Recherche bei künstlichen Intelligenzen wie ChatGPT, die juristische Einschätzungen liefern können (wenn auch ohne Gewähr), legt nahe, dass das Bekleben von Produkten im Supermarkt ohne Genehmigung des Händlers weitreichende Konsequenzen haben kann.
Das Anbringen von Stickern auf Produkte bedeutet, dass fremdes Eigentum – die Ware gehört dem Händler und nicht dem Produzenten – verändert wird. Juristisch kann dies als Sachbeschädigung nach Paragraph 303 StGB oder als Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gewertet werden. Selbst wenn der Sticker rückstandslos entfernbar ist, entscheiden Gerichte in solchen Fällen oft, dass bereits die „nicht unerhebliche Veränderung der Sache“ für eine Sachbeschädigung ausreicht. Zudem können zivilrechtliche Ansprüche entstehen, beispielsweise wenn aufgrund der Beklebung weniger Produkte gekauft werden und dem Händler dadurch ein wirtschaftlicher Schaden entsteht. Das Verdecken von Kalorienangaben oder anderen wichtigen Informationen auf der Verpackung könnte ebenfalls rechtliche Relevanz haben.
Des Weiteren haben Supermärkte ein Hausrecht. Aktionen wie das Bekleben von Waren sind ohne Genehmigung nicht erlaubt. Wer beim Bekleben erwischt wird, kann des Ladens verwiesen werden oder ein Hausverbot erhalten. Die möglichen Folgen sind vielfältig: Zivilrechtlich kann der Händler Schadensersatz verlangen, etwa wenn Produkte entsorgt werden müssen. Strafrechtlich sind Anzeigen wegen Sachbeschädigung oder Hausfriedensbruch denkbar. Ordnungsrechtlich kann es als Ordnungswidrigkeit wegen unbefugter Plakatierung gewertet werden. Das Fazit ist eindeutig: Die Behauptung, es sei erlaubt, ist falsch. Das Kleben von Stickern auf Produkte in Supermärkten ist, auch bei politischen Aktionen, grundsätzlich nicht erlaubt.

Das Gegenteil bewirken: Historische Parallelen
Die Geschichte politischer Protestaktionen zeigt immer wieder, dass sie oft das Gegenteil dessen bewirken, was ursprünglich beabsichtigt war. Campact wollte mit seiner Aktion Müller-Produkte stigmatisieren und die AfD diskreditieren. Doch die geschickte Reaktion von Alice Weidel könnte dazu führen, dass die Kampagne ins Leere läuft oder sogar eine positive Wirkung für die AfD entfaltet. Es gab in der Vergangenheit ähnliche Fälle, in denen Boykottaufrufe oder negative Kampagnen für die Zielperson oder -partei unerwartete Vorteile brachten.
Man erinnere sich an die „Schuh-Aktion“ beim Spiegel, bei der eine Titelstory über „AfD-Schuhe“ letztlich dazu führte, dass viele Menschen begannen, sich eben solche Schuhe zu personalisieren. Oder das Sommerinterview mit Alice Weidel, das von einer anderen Aktivistengruppe, dem Zentrum für Politische Schönheit, gestört werden sollte. Auch hier hatte die AfD im Anschluss einen Zuwachs an Zustimmung. Solche Aktionen, die eigentlich schaden sollen, können unter Umständen zu einer erhöhten Aufmerksamkeit und sogar zu einem Sympathiebonus führen, wenn die Zielgruppe das Gefühl hat, dass die betroffene Partei ungerechtfertigt angegriffen wird.
Sollte die aktuelle Sticker-Aktion von Campact tatsächlich eine bundesweite Dimension erreichen und zu einer ungewollten Werbung für die AfD führen, könnte dies die Partei zum ersten Mal über die 30-Prozent-Marke in Umfragen befördern. In einem solchen Szenario müsste die AfD ironischerweise überlegen, inwieweit sie diese unfreiwillige „Werbung“ von Campact als Spende angeben muss.

Fazit: Ein Schlagabtausch mit ungewissem Ausgang
Die Campact-Aktion und Alice Weidels Konter sind ein faszinierendes Beispiel für die Dynamik politischer Auseinandersetzungen im digitalen Zeitalter. Was als scheinbar einfacher Protest begann, hat sich zu einem vielschichtigen Konflikt entwickelt, der juristische, ethische und strategische Fragen aufwirft. Während Campact die Konsumenten aufklären und zum Boykott aufrufen wollte, nutzte Weidel die Gelegenheit, die Narrative umzudrehen und die Aktion für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren.
Der Ausgang dieser „Sticker-Schlacht“ ist noch ungewiss. Es bleibt abzuwarten, ob Campact seine Ziele erreicht oder ob die AfD gestärkt aus dieser Konfrontation hervorgeht. Eines ist jedoch sicher: Die Grenzen zwischen Meinungsäußerung, Protest und potenzieller Sachbeschädigung sind fließend, und die Öffentlichkeit wird weiterhin gespannt verfolgen, wie sich dieser ungewöhnliche politische Schlagabtausch weiterentwickelt. Die Debatte über die Rolle von NGOs, die Macht sozialer Medien und die Reaktion etablierter Parteien auf unkonventionelle Protestformen ist mit dieser Aktion definitiv neu entfacht worden.