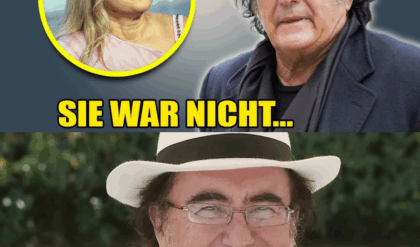Es ist der 4. November 2022, ein Tag, der in die Geschichtsbücher der Europäischen Union eingehen könnte. Der Plenarsaal in Brüssel ist voll besetzt, die Luft ist zum Schneiden gespannt. Doch was dann geschieht, ist kein normaler politischer Schlagabtausch. Es ist ein Aufstand, ein gezielter Angriff auf das Herz der europäischen Macht. Viktor Orbán, der ungarische Premierminister, tritt ans Rednerpult. Er wirkt ruhig, fast eisern. Er hat keine Notizen, keine Berater an seiner Seite. Sein Blick ist starr auf eine einzige Person gerichtet: Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Dann fällt der Satz, der den Saal in absolute Stille taucht. Eine Stille, die lauter dröhnt als der heftigste Tumult. “Frau Präsidentin”, sagt Orbán mit fester Stimme, “Ihre Zeit ist vorbei”.
Dieser Moment ist mehr als nur eine Provokation. Es ist eine Zäsur. Keine Zwischenrufe, kein Murmeln. Nur das kollektive Luftholen eines Parlaments, das Zeuge wird, wie die ungeschriebenen Regeln der Brüsseler Diplomatie pulverisiert werden. Orbán hat nicht nur Kritik geäußert; er hat eine Ära für beendet erklärt.
Was folgt, ist eine Generalabrechnung, eine “bittere Diagnose”, wie er es nennt, eines Systems, das sich seiner Meinung nach selbst überlebt hat. Orbán wirft der EU-Führung nicht weniger als den Verlust jeglicher Glaubwürdigkeit vor. Er spricht von Korruption, von Machtmissbrauch und von politisch motivierten Sanktionen, die Europa mehr schaden als dem, den sie treffen sollen.

Der Kern seiner Anklage ist greifbar und finanziell bezifferbar. Er nutzt Zahlen, keine bloßen Emotionen, um seine Punkte zu untermauern. “Sieben Fehlentscheidungen, 12 Monate politischer Stillstand, 20 Milliarden Euro eingefrorener Gelder”. Die Zahl 20 Milliarden wiederholt er, hämmert sie ins Bewusstsein der Abgeordneten. Es sind jene Gelder, die Ungarn aufgrund angeblicher Rechtsstaatlichkeitsprobleme vorenthalten werden. Für Orbán ist das klar: “Das ist keine Rechtsstaatlichkeit, das ist Erpressung”.
Mit dieser Anschuldigung reißt er eine Wunde auf, die seit Jahren schwärt. Doch er bleibt nicht bei Ungarn stehen. Er macht sich zum Sprachrohr für eine weitverbreitete Unzufriedenheit, die quer durch den Kontinent zu spüren ist. Er spricht über die Energiekrise, die Millionen Menschen in ihren Grundfesten erschüttert. Er spricht über die untragbar hohen Preise, die Belastungen für Familien, die ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können, und die tiefe Unsicherheit über die Versorgung im kommenden Winter.
Er schlägt eine Brücke zu den Landwirten, nicht nur in Ungarn, sondern auch in Polen, Frankreich und Deutschland. Er beschreibt, wie die “überstürzte Marktöffnung” für ukrainisches Getreide Bauern an den Rand der Existenz getrieben habe. Er malt das Bild einer Elite in Brüssel, die Entscheidungen über die Köpfe derer hinweg trifft, die die Konsequenzen tragen müssen.
Und er geht noch weiter. Er greift eines der sensibelsten Themen der modernen Politik auf: die Meinungsfreiheit. Er zielt direkt auf den “Digital Services Act”. Dieser Akt, so Orbáns drastische Anklage, habe zu Zensur geführt. “Oppositionelle Stimmen verschwinden”, ruft er in den Saal, “und das nennen Sie Schutz”. Ein Stich ins Wespennest, denn die Debatte über die Grenzen zwischen Schutz vor Desinformation und politischer Zensur wird längst nicht mehr nur hinter verschlossenen Türen geführt.
Orbán ist an diesem Tag nicht gekommen, um Freunde zu finden. Er ist gekommen, um die Verantwortlichen zu benennen. Er liest eine Liste von Namen vor, die wie eine Anklageschrift klingt: Manfred Weber, Pedro Sánchez, Ska Keller, Mark Rutte, Emmanuel Macron, Robert Habeck. Und natürlich, immer wieder: Ursula von der Leyen. Er nennt sie eine “Allianz der Zentralmacht”, die Europa nicht vereint, sondern tiefer gespalten habe als je zuvor.
Die Leidtragenden dieser Politik, so Orbán, seien nicht die Eliten in ihren Brüsseler Büros. “Die Leidtragenden sind die Bürger”, betont er. “Bauern, Arbeiter, Familien, Rentner. Menschen, die jeden Tag spüren, wie Entscheidungen aus Brüssel ihren Alltag erschweren, ohne dass jemand ihnen zuhört”.
Die Reaktion im Parlament ist ein Spiegelbild der Zerrissenheit Europas. Einige rufen “Skandal!”, andere schütteln fassungslos den Kopf. Doch dann geschieht das Unerwartete. Das, was diesen Moment so gefährlich für die Kommissionspräsidentin macht. Ein französischer Abgeordneter ruft laut: “Er hat recht!”. Ein portugiesischer Sozialdemokrat, meilenweit von Orbáns politischem Lager entfernt, murmelt: “Wir haben viel zu lange geschwiegen”.
Beobachter stellen fest, was undenkbar schien: Der Block hinter von der Leyen bröckelt. Selbst innerhalb der EVP, ihrer eigenen politischen Familie, zeigen Abgeordnete offen ihr Unbehagen. Orbán hat nicht nur provoziert; er hat eine tektonische Verschiebung ausgelöst. Er hat Zweifel gesät und latente Unzufriedenheit in offene Rebellion verwandelt.
Die Schockwellen verlassen den Plenarsaal augenblicklich und breiten sich global aus. In den USA hält man sich offiziell bedeckt, doch konservative Medien sprechen von einem “Brüsseler Zusammenbruch”. Russland kommentiert die Spaltung Europas mit unverhohlenem Spott. China nutzt die Gelegenheit, um “strategische Kooperation” anzubieten. Besonders laut ist das Schweigen aus Italien, während aus Polen und der Slowakei unterstützende Signale in Richtung Budapest gesendet werden. Orbáns Angriff ist kein interner Konflikt mehr; er ist ein globales Ereignis, das die geopolitische Landkarte Europas neu zu zeichnen droht.
Kern seiner Rede ist eine fast schon systemische Frage, die seit Jahren unter der Oberfläche brodelt: “Wer regiert Europa wirklich?”. Sind es die demokratisch gewählten Bürger? Oder, wie Orbán suggeriert, ein undurchsichtiger Netzwerk aus Kommissaren, einflussreichen Lobbyisten, globalen Konzernen und teuren Beratungsfirmen?
Um diese These zu stützen, zerreißt er den Vorhang der Brüsseler Selbstgefälligkeit und erinnert an die Skandale der jüngsten Vergangenheit: Qatargate, die dubiosen Impfstoffdeals und die “verschwundenen Milliarden” im Green Deal. Für viele Bürger, besonders jene, die das europäische Projekt seit Jahrzehnten mit einer Mischung aus Hoffnung und Skepsis beobachten, klingen diese Worte wie eine bittere, aber schmerzhaft reale Bestandsaufnahme.
Orbáns Strategie ist klar: Er will Europa nicht über das System verändern, sondern gegen das System. Seine heutige Rede ist ein entscheidender Baustein in seinem Plan, eine “patriotische Allianz” zu schmieden, die die Machtverhältnisse im Parlament fundamental verschieben könnte.
Während Orbán den Saal verlässt, bricht in Brüssel Hektik aus. Krisenteams werden einberufen. Erste Berichte sickern durch: Mehrere Abgeordnete der politischen Mitte erwägen, sich bei einer möglichen Misstrauensabstimmung zu enthalten oder sogar dagegen zu stimmen. Sieben potenzielle Abweichler gelten als sicher, zwölf weitere als unentschlossen. Die kritische Schwelle von 20 Stimmen, die eine Mehrheit brechen könnte, rückt gefährlich nahe. Noch ist nichts offiziell, doch in den Fluren des Parlaments wird ein Wort geflüstert, das bisher tabu war: “Rücktritt”.

Gerade in Deutschland, dem wirtschaftlichen Motor der EU, treffen Orbáns Worte einen wunden Punkt. Die explodierenden Energiepreise belasten die Wirtschaft. Rentner sehen ihre Kaufkraft schwinden. Viele Bürger fühlen sich von der Politik in Berlin und Brüssel nicht nur übergangen, sondern vergessen. Ob man Orbán nun unterstützt oder ihn als Gefahr für die Demokratie sieht – seine Rede spiegelt die Sorgen vieler Menschen wider: Zu viel Bürokratie, zu wenig Realitätssinn, zu hohe Preise, zu wenig Kontrolle über die eigene Zukunft.
Orbáns Rede endet so abrupt, wie sie begonnen hat. Mit einer letzten, düsteren Warnung, die durch die Hallen des Parlaments dröhnt: “Europa steht an einer Grenze. Entweder wir kehren zur Freiheit zurück, oder wir verlieren sie endgültig”.
Er geht. Zurück bleibt ein Chaos aus Applaus, Pfiffen, empörten Rufen und überraschender Zustimmung. Europa steht an einem Wendepunkt. Dieser 4. November 2022 war kein gewöhnlicher politischer Streit. Es war ein Moment, der die Zukunft der Union maßgeblich prägen wird. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Brüssel versucht, zur Tagesordnung überzugehen, oder ob dieser Angriff das Fundament der Kommission unwiderruflich erschüttert hat.