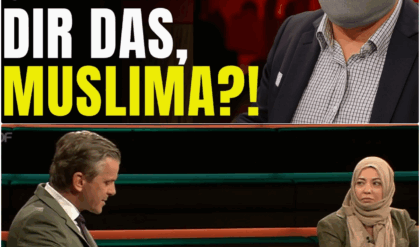Es ist mehr als nur ein Gerichtsverfahren. Es ist ein öffentliches Schauspiel, ein Familiendrama von shakespeareschem Ausmaß und ein Justiz-Thriller, der derzeit die Grundfesten des Vertrauens in das Rechtssystem erschüttert. Der sogenannte „Block-Prozess“ in Hamburg ist längst zu einem Synonym für einen Kampf geworden, bei dem die Grenzen zwischen Recht, Moral und persönlicher Tragödie verschwimmen. Im Zentrum dieses Orkans steht nun eine Frau, die eigentlich für Ordnung sorgen soll: die Vorsitzende Richterin Isabelle Hildebrand. Doch genau sie befindet sich im Fadenkreuz massiver Angriffe. Befangenheitsanträge stapeln sich, Vorwürfe der Voreingenommenheit werden laut, und eine diffuse, fast greifbare Intuition liegt im Raum: Dieser ganze Prozess könnte platzen.
Die Luft im Gerichtssaal muss zum Schneiden gespannt sein. Es ist der 19. Prozesstag, und die Anspannung entlädt sich. Rechtsanwältin Pina, die Verteidigerin des ehemaligen LKA-Chefs Andreas P., ergreift das Wort. Ihre Anklage ist schwerwiegend: Die Rechte ihres unschuldigen Mandanten würden „mit Füßen getreten“. Ein Satz, der wie ein Peitschenhieb durch den Saal gellt. Richterin Hildebrand, bekannt für ihre direkte Art, reagiert sofort, hakt nach: „Wollen Sie mir vorwerfen, dass ich diese Rechte mit Füßen trete?“ Es ist ein offener Schlagabtausch, der die tiefe Kluft zwischen Verteidigung und Gericht offenbart.

Doch dies ist nur die Spitze des Eisbergs. Es ist ein Mehrfrontenkrieg, der gegen die Richterin geführt wird. Auch die Anwälte der Mitangeklagten – eine Cousine und deren Ehemann, die wegen Beihilfe vor Gericht stehen – beschweren sich. Sie müssen seit Wochen in diesem Prozess ausharren, obwohl ihre mutmaßliche Rolle in dem Drama verschwindend gering gewesen sein soll. Man stelle sich die Zermürbung vor: Tag für Tag in einem Prozess gefangen zu sein, der das eigene Leben lahmlegt, während man sich als kleines Rädchen in einem riesigen, monströsen Getriebe fühlt.
Und dann ist da noch der Patriarch der Familie, Eugen Block. Ein Mann, der es gewohnt ist, das Zepter in der Hand zu halten. Auch er sieht das Recht auf seiner Seite nicht mehr gewahrt. Mit einer öffentlichen Mitteilung lässt er verlauten, dass er eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Richterin Hildebrand eingereicht hat. Der Anlass ist so bizarr wie brisant: Eine Kollegin der Richterin hat der Presse ein Interview gegeben. In diesem lobt sie Hildebrand über den grünen Klee, preist sie als „sehr geschätzte Richterin“ und hebt ihre hervorragende Arbeit am Gericht hervor.
Was wie eine kollegiale Geste wirken mag, ist in der angespannten Atmosphäre des Block-Prozesses pures Dynamit. Prozessbeobachter und Juristen sind sich einig: Solche Interviews während eines laufenden, hochbrisanten öffentlichen Verfahrens sind absolut unüblich. Sie werfen einen Schatten auf die Unparteilichkeit, die das Gericht wahren muss. Eugen Block und seine Verteidiger interpretieren dies als klares Indiz: Dieses Verfahren wird anders behandelt, es wird besonders behandelt. Es nährt den Verdacht, dass hier nicht mehr mit gleichen Ellen gemessen wird. Es ist ein Gefühl, das sich bei vielen Beobachtern über die letzten Jahre verfestigt hat – das Gefühl, dass geltendes Recht in dieser Familiensaga auf seltsame Weise dehnbar geworden ist.
Als wäre all dies nicht genug, schwelt unter der Oberfläche ein juristischer Skandal, der die Macht hat, das gesamte Kartenhaus zum Einsturz zu bringen. Mehrere Verteidiger, darunter der bekannte Ingo Bott, haben einen weiteren schweren Vorwurf erhoben. Sie beanstanden, dass die Ermittler IT-Beweismittel – mutmaßlich ein Notizbuch oder Tagebuch vom Handy der Angeklagten Christina Block – nicht rechtmäßig ausgelesen haben sollen. Diese womöglich illegal erlangten, intimen Aufzeichnungen wurden dem Gericht als Beweismittel zur Verfügung gestellt.
Die Verteidigung sieht darin einen klaren Verstoß gegen rechtsstaatliche Prinzipien. Sie halten die Verwertung dieser Beweise für unzulässig und haben Beschwerde eingereicht. Die Brisanz ist kaum zu überschätzen. Sollte eine höhere Instanz – denn Hildebrand selbst wird hierüber nicht entscheiden – zu dem Schluss kommen, dass diese Beweise „vergiftet“ sind, könnten sie aus dem Verfahren fliegen. Was bliebe dann von der Anklage übrig? Diese Entscheidung, die nun bei einer anderen Kammer liegt, hängt wie ein Damoklesschwert über dem Saal.
Es ist kein Wunder, dass sich unter den Angeklagten und ihren Verteidigern der Eindruck verfestigt hat, die Richterin sei befangen und agiere nicht fair. Ob diese Anträge juristisch durchdringen, steht auf einem anderen Blatt. Doch der Schaden für das Vertrauen in den Prozess ist bereits angerichtet.
Inmitten dieses Sturms steht Richterin Isabelle Hildebrand. Prozessbeobachter beschreiben ihr Auftreten als „sehr unsympathisch“. Doch selbst Kritiker müssen zugeben: Der Druck, der auf dieser Frau lastet, ist unmenschlich. Man muss sich das Szenario vergegenwärtigen: Ein Gerichtssaal, belagert von der Presse. Ein Liveticker, der jede Regung, jedes Wort nach außen trägt. Eine Öffentlichkeit, die gierig auf jede neue Wendung wartet. Jede Entscheidung, jede noch so kleine Geste, jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt, seziert und interpretiert. Es ist ein Verhandeln unter einem Mikroskop, das jede menschliche Schwäche gnadenlos vergrößert. Wer könnte unter solchen Bedingungen fehlerfrei bleiben?
Genau diese Gemengelage aus juristischen Fallstricken, emotionalen Eruptionen und öffentlichem Druck nährt eine dunkle Vorahnung: Der Prozess könnte platzen. Es ist eine Intuition, die sich nicht auf Paragrafen stützt, sondern auf die schiere Komplexität und Zerrüttung des Falles. Das Verfahren ist so diffus, so verworren, dass es kaum noch zu durchdringen ist.

Es erinnert an Taktiken, die man sonst nur aus sogenannten „Rockerprozessen“ kennt. Dort werden Befangenheitsanträge oft inflationär genutzt, um Verfahren gezielt zu verzögern, die Justiz zu zermürben und am Ende vielleicht einen Verfahrensfehler zu provozieren, der alles zunichtemacht. Ob dies hier die Strategie ist, bleibt Spekulation. Doch die Konsequenzen einer solchen Verzögerung wären in diesem Fall ungleich dramatischer.
Denn hier geht es nicht um organisierte Kriminalität, sondern um eine Familientragödie. Hier sitzen Menschen auf der Anklagebank, die nie Personen der Öffentlichkeit sein wollten. Menschen wie die Cousine und ihr Ehemann, die vielleicht nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren, die ein Auto von A nach B gefahren haben, ohne das ganze Ausmaß zu ahnen. Und noch gravierender: Ein Angeklagter sitzt seit extrem langer Zeit in Untersuchungshaft.
Die U-Haft ist eines der schärfsten Schwerter des Rechtsstaats. Ein Mensch wird seiner Freiheit beraubt, bevor seine Schuld bewiesen ist. Prozessbeobachter, die selbst Erfahrung mit langwierigen Verfahren haben, wissen, wie sehr Gerichte eigentlich darum bemüht sein müssen, schnell zu verhandeln. Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, niemanden unnötig lange diesem Druck und dem Freiheitsentzug auszusetzen. Jeder Tag, den der Block-Prozess durch Anträge und Beschwerden verliert, ist ein weiterer Tag in U-Haft für einen Mann, für den noch immer die Unschuldsvermutung gilt.
Das Verfahren in Hamburg ist jedoch nur die Hauptbühne. Ringsherum toben die „Nebenschauplätze“ weiter. In Frankfurt, in Dänemark – überall laufen Verfahren, in denen Christina Block und ihr Ex-Mann Stefan Hensel gegeneinander streiten. Mal gewinnt der eine, mal die andere. Es ist ein juristischer Abnutzungskrieg, ein „Rattenschwanz“, der sich unaufhaltsam durch das Leben aller Beteiligten frisst.
Und das führt uns zum emotionalen Kern dieses Dramas, zu der Person, die im Zentrum all dessen zu zerbrechen droht: Christina Block. Die Frage, die im Raum steht und die Beobachter mit Sorge erfüllt, lautet: Wie lange hält diese Frau das noch durch? Wie lange kann ein Mensch diesen unvorstellbaren Druck aushalten? Es ist nicht nur der Druck einer Angeklagten. Es ist der Schmerz einer Mutter, die ihre Kinder seit vier Jahren nicht mehr sehen durfte.
Vier Jahre. Eine Zeitspanne, in der Kinder sich verändern, aufwachsen, sich entfremden. Dieser Schmerz ist in jeder Faser des Prozesses spürbar. Er erklärt vielleicht auch die Momente, in denen Christina Block im Gerichtssaal das Wort ergreift, um Dinge zu sagen, die scheinbar nichts mit der Anklage zu tun haben. Wenn die Richterin sie dann ermahnt: „Kommen Sie zur Sache! Keine Angriffe, keine anderen Erklärungen!“, mag das juristisch korrekt sein, um den Fokus des Verfahrens zu wahren.
Doch Christina Block entgegnet darauf etwas, das die ganze Tragödie dieses Verfahrens offenbart: „Das ist meine einzige Möglichkeit, überhaupt mit meinen Kindern zu kommunizieren.“ Der Gerichtssaal, ein Ort des Rechts, wird für sie zur letzten, verzweifelten Brücke zu ihren Kindern – eine Botschaft in die Welt hinaus, in der Hoffnung, dass sie die Empfänger erreicht.

Es ist diese unauflösbare Verstrickung von juristischer Schuldfrage und menschlichem Leid, die den Prozess so „sehr, sehr verworren“ macht.
Was also passiert, wenn der Prozess platzt? Wenn die Befangenheitsanträge Erfolg haben oder die Beweismittel gekippt werden? Die Antwort ist niederschmetternd: Es gibt keine Gewinner. Es bedeutet nicht das Ende des Albtraums, sondern den Anfang. Das ganze Drama beginnt von vorn. Neue Richter, neue Verhandlungstage, eine neue Runde im zermürbenden Kampf.
Seit dem Tag, an dem die Kinder das erste Mal nicht zur Mutter zurückgebracht wurden, gibt es in dieser Geschichte nur noch Verlierer. Und das Justizsystem, das eigentlich dazu da ist, Konflikte zu lösen und Gerechtigkeit zu schaffen, wirkt in diesem Fall überfordert, fast ohnmächtig. Es ist gefangen in seinen eigenen Paragrafen, während das menschliche Drama dahinter immer tiefere Wunden reißt.