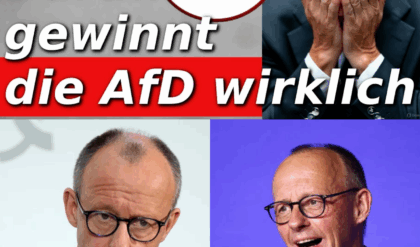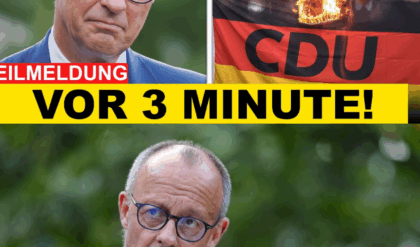Es gibt Momente im Fernsehen, die mehr sind als nur Unterhaltung. Es sind Momente, in denen die sorgfältig konstruierte Fassade der politischen Rhetorik Risse bekommt und die ungeschminkte, oft schmerzhafte Realität hervorbricht. Ein solcher Moment ereignete sich kürzlich in einer Talkshow, die eigentlich als zivilisierter Diskurs gedacht war. Auf der einen Seite saß Katharina Schulze, eine prominente Vertreterin der Grünen, bewaffnet mit den politischen Narrativen und Lösungsansätzen ihrer Partei. Auf der anderen Seite eine Unternehmerin, eine Frau aus dem Herzen des deutschen Mittelstands, die seit über 100 Jahren ein Industrieunternehmen in der Baubranche führt.
Was als Gespräch begann, eskalierte zu einer Generalabrechnung. Es war der Moment, in dem der Unternehmerin der Kragen platzte. Es war die Kollision zweier Welten: die der politischen Theorie und die der wirtschaftlichen Praxis. Und es war ein Weckruf, der an Deutlichkeit nicht zu überbieten war.

Die Debatte begann, wie so oft, mit einer Bestandsaufnahme der Probleme. Schulze, in ihrer Rolle als Politikerin, zeigte Verständnis. Ja, man sei sich bewusst, dass das Leben teurer geworden sei, dass die Mieten explodieren. Man höre den Bürgern und Unternehmern zu. Als Lösungen präsentierte sie das bekannte Portfolio ihrer Partei: das Deutschlandticket müsse bleiben und günstiger werden, die Mietpreisbremse müsse verschärft und mehr Wohnraum geschaffen werden. Sie schlug sogar vor, die Grunderwerbsteuer für die erste selbstgenutzte Immobilie zu streichen. Es klang alles vernünftig, durchdacht und sozial ausgewogen.
Doch diese Antworten schienen die Unternehmerin, die tagtäglich mit den existenziellen Sorgen eines produzierenden Betriebs kämpft, nicht mehr zu erreichen. Für sie klangen diese Vorschläge wie das Verabreichen von Pflastern, während der Patient innerlich verblutet.
Als sie das Wort ergriff, war die Anspannung im Studio greifbar. Sie bestätigte die dramatische Lage. Ja, es sei dramatisch. Sie spreche nicht nur für ihr eigenes Stahlbeton-Unternehmen, sondern für unzählige Mittelständler im ganzen Land. “Tatsächlich wird’s immer schwieriger am Standort Deutschland”, sagte sie, und ihre Stimme war fest. Sie sprach von einer “verfehlten Wirtschaftspolitik”, die dazu führe, dass Unternehmer zumachen, Standorte verlagern und Arbeitsplätze in einem erschreckenden Tempo gestrichen werden.
Dann fiel der Satz, der die grüne Politik in ihren Grundfesten traf: Das viel “prophezeite grüne Wirtschaftswunder”, so die Unternehmerin, “haben wir bis dato nicht erlebt. Und ich glaube auch, dass es so nicht eintreten wird.”
Es war eine direkte Kampfansage an das Kernversprechen der Grünen. Die Unternehmerin diagnostizierte die Krankheit des Standorts Deutschland mit drei einfachen, brutalen Worten: “Wir sind zu langsam, wir sind zu bürokratisch, und wir sind zu teuer.”
Den verheerendsten Schlag aber hob sie sich für das grüne Prestigeprojekt auf: die Energiewende. Sie räumte ein, dass der Gedanke, alles auf saubere Energie umzustellen, “sich alles gut angehört” habe. Doch dann kam das Aber, das wie ein Peitschenhieb durchs Studio knallte: “Wir müssen uns der Realität ins Auge blicken: Wir schaffen das so nicht.”
Sie zeichnete ein Bild von Deutschland, das Gänsehaut erzeugt. “Deutschland ist mit der Klima- und Energiepolitik der Geisterfahrer”, erklärte sie. Während die Welt zuschaue, wie Deutschland saubere, stabile Energie – die Kernkraft – abschalte, würden über 50 andere Länder, darunter die USA, Großbritannien und Frankreich, massiv in genau diese neuen Kernkraft-Technologien investieren.

Um die Absurdität der deutschen Strategie zu verdeutlichen, nutzte sie eine brillante Metapher. Deutschland, so sagte sie, sei ein Supermarkt, der 24 Stunden, sieben Tage die Woche geöffnet haben muss. Wind und Sonne seien der “Biobauer”, der zwar “wunderbare Produkte” liefere, aber eben nur, wenn das Wetter gut ist. Manchmal produziere er zu viel, dann müsse man die Ware verschenken. Die Kernenergie hingegen, so die Unternehmerin, sei “das Zentrallager” gewesen. Ein Lager, das immer liefere, egal ob Sturm oder Schnee.
“Und was haben wir gemacht?”, fragte sie rhetorisch in die betretene Stille. “Wir haben das Zentrallager geschlossen.”
Die Konsequenzen seien fatal: keine Stabilität, kein Vertrauen in den Standort. Die Unternehmer wüssten nicht mehr, ob sie in Deutschland noch investieren sollen, und zögen sich massiv zurück. Sie prangerte die “Realitätsverweigerung” der Politik an und zitierte den Bundesrechnungshof, der in einem Sonderbericht feststellte, dass Deutschlands Versorgungssicherheit “massiv gefährdet” sei, die Ziele verfehlt und eine kohärente Strategie fehle.
Ihr Appell war eindringlich: “Nehmt die Sorgen und Ängste der Wirtschaft ernst, der Menschen in unserem Land, die sich das Leben nicht mehr leisten können!” Und dann, mit einer Schärfe, die Katharina Schulze sichtlich traf: “Wir müssen aufhören mit grünen ideologischen Träumereien. Wir sehen, es funktioniert nicht!”
Katharina Schulze, konfrontiert mit dieser Flut an Fakten aus der Praxis, wirkte zunehmend überfordert. Der Kommentator des Videos sprach von “Schnappatmung”. Sie versuchte, die deutsche Politik als eine Reaktion auf eine “Umbruchphase” zu verteidigen, in der alte Gewissheiten wie billiges Gas aus Russland weggefallen seien. Sie stimmte sogar zu, dass ein “Hü und Hot” wie beim Verbrenner-Aus “alle narrisch im Kopf” mache – eine ironische Volte, da ihre Partei genau dies vorangetrieben hatte.
Als die Unternehmerin die Kernkraft als Lösung ins Spiel brachte, war Schulzes einzige Erwiderung, dass der Bau von AKWs “technisch einfach … so schnell doch nicht” möglich sei. Ein Argument, das die Unternehmerin nicht gelten ließ, da es den Mangel an langfristiger Planung und den bürokratischen Wahnsinn nur bestätigte, anstatt ihn zu lösen.
Doch die Unternehmerin war noch nicht fertig. Sie weitete ihre Kritik von der Wirtschafts- auf die Sozialpolitik aus und nannte die Einführung des Bürgergelds eine “fatale Entscheidung”. In einer Zeit, in der ihr Industriebetrieb und unzählige andere händeringend “Arbeiter für die Produktion” suchen, sei es “schier unmöglich”, Personal zu finden. Der Grund sei klar: “Weil sich einfach sehr viele, die arbeiten könnten, dann auf das Bürgergeld verlassen haben.”

Es sei nicht mehr zu akzeptieren, dass sich Menschen auf dem Sozialstaat ausruhen, während die Wirtschaft am Boden liege. Und sie zögerte nicht, die politische Konsequenz zu benennen: Genau diese Frustration sei es, die die “Wählerbewegungen” hin zu Parteien wie der AfD befeuere.
Am Ende ihrer Brandrede stand kein Zorn mehr, sondern ein fast schon verzweifelter Appell. Was fehle, sei ein Plan, eine “positive Zukunftsvision”. Sie berichtete von ihren Reisen: “All diese Länder haben eins gemeinsam: Die haben Bock auf Zukunft, die haben Lust, was zu reißen, die haben eine Aufbruchsstimmung.”
Genau das, so forderte sie, müsse man jetzt in Deutschland erzeugen. Man müsse durch das “Tal der Tränen” laufen, aber mit dem Wissen, dass man eine “richtige Realpolitik” eingeschlagen habe.
Es war eine Rede, die man sich, wie der Kommentator anmerkte, von einem Bundeskanzler gewünscht hätte. Eine Rede, die Mut machte, weil sie die Probleme klar benannte, statt sie in ideologischen Phrasen zu verstecken.
Von Katharina Schulze kam dazu nichts mehr. Die Unternehmerin hatte mit der Wucht der Realität die grünen Träumereien zum Platzen gebracht. Die Sendung endete nicht mit einem Abbruch, wie der Titel reißerisch andeutete, sondern mit etwas viel Bedeutsamerem: mit dem betretenen Schweigen einer Politik, der angesichts der knallharten Wahrheit die Argumente ausgegangen waren.