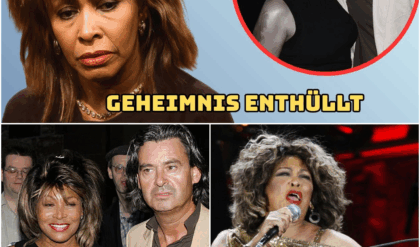Deutschland befindet sich in einem politischen Ausnahmezustand. Die Signale verdichten sich seit Wochen, nun ist das Beben in den Umfragen manifest: Die schwarz-rote Koalition unter Kanzler Friedrich Merz steht massiv unter Druck. In Berlin wird nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand, sondern offen die Frage diskutiert, ob dem Kanzler am Ende nur noch der drastischste aller Schritte bleibt: vorgezogene Neuwahlen und die Auflösung des Bundestages.
Auslöser dieser existenziellen Krise ist ein Datensatz, der das politische Gefüge der Bundesrepublik in seinen Grundfesten erschüttert. Eine aktuelle Insa-Erhebung präsentiert ein Bild, das es in dieser Form noch kaum gab. In der direkten Kanzlerfrage, dem ultimativen Indikator für politisches Vertrauen, liegt Oppositionsführerin Alice Weidel von der AfD leicht vor dem amtierenden Kanzler Friedrich Merz. Ein größerer Teil der Befragten würde sich demnach für Weidel entscheiden, Merz kommt nur auf einen geringeren Wert. Für politische Beobachter ist dies weit mehr als eine Momentaufnahme; es ist das brutale Symbol für einen tief sitzenden Vertrauensverlust in die gesamte Regierung.

Doch es bleibt nicht bei der Kanzlerfrage. Die klassische Sonntagsfrage zeichnet ein Bild der Zerrüttung für die etablierten Kräfte. Union und AfD liegen mit jeweils etwa 25,5 Prozent gleichauf. Diese Zahl muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Die CDU/CSU, über Jahrzehnte die “natürliche” Regierungspartei Deutschlands, bewegt sich nur noch auf Augenhöhe mit einer Partei, die lange primär als Protestkraft abgetan wurde. Insa-Chef Hermann Binkert spricht von einem historischen Höchstwert für die AfD und sieht sie im Moment als die stärkste politische Kraft im Land.
Die Regierungsparteien wirken im Lichte dieser Zahlen wie angeschlagene Boxer. CDU, CSU und SPD kommen gemeinsam nur noch auf knapp unter 40 Prozent. Sie hätten nach heutigem Stand keine eigene Mehrheit mehr. Die SPD, der Koalitionspartner der Union, fällt auf dramatische 14 Prozent, bei den sicheren Wählern liegt sie sogar noch deutlich darunter. Die Grünen bewegen sich im niedrigen zweistelligen Bereich, und die FDP muss weiterhin um ihren bloßen Einzug in den Bundestag bangen.
Parallel zu diesem Absturz der Regierung wächst die Unzufriedenheit in der Bevölkerung auf ein bedrohliches Maß. Ein Großteil der Befragten gibt an, die Leistung der Bundesregierung sei “schlechter als erwartet”. Nur ein verschwindend kleiner Teil zeigt sich “positiv überrascht”. Beobachter sprechen von einer der unpopulärsten Regierungen seit Langem.
Woher kommt dieser massive Vertrauensverlust? Ein zentraler Kritikpunkt ist die wahrgenommene Handlungsunfähigkeit der Koalition. Statt des vollmundig angekündigten Aufbruchs erlebt die Öffentlichkeit eine Endlosschleife aus innerkoalitionären Konflikten, vertagten Entscheidungen und der bequemen Abschiebung von Problemen in diverse Kommissionen. Ob Gesundheit, Pflege, Rente oder Infrastruktur – in allen zentralen Bereichen, die das Leben der Bürger direkt betreffen, scheinen echte Lösungen auf sich warten zu lassen, während die Finanzierungslücken immer sichtbarer werden.
Strukturelle Probleme wie der demografische Wandel, explodierende Sozialausgaben, hohe Energiepreise und die ungelösten Folgen der Migrationspolitik prallen in den Debatten ungebremst aufeinander. Je nach politischem Lager werden die Schuldigen gesucht: Die einen verweisen auf die historischen Entscheidungen unter Angela Merkel, andere auf globale Krisen, europäische Vorgaben oder schlicht auf die fehlende strategische Linie der aktuellen Regierung.
In dieser aufgeheizten Situation rücken die innerparteilichen Bruchlinien in den Mittelpunkt. Besonders in der Union von Kanzler Merz tobt eine intensive Debatte über die sogenannte Brandmauer zur AfD. Das Dogma der totalen Abgrenzung, einst von Merz selbst zur Chef-Sache erklärt, beginnt zu bröckeln. Es sind prominente ehemalige Unionspolitiker, die nun eine grundsätzliche Überprüfung dieser Linie anregen.

Der frühere Generalsekretär Peter Tauber warnt davor, jedes Thema nur noch danach zu bewerten, ob die AfD eine ähnliche Position vertritt. Diese Haltung, so die Sorge, lähme die parlamentarische Arbeit vollständig. Der Historiker und CDU-Politiker Andreas Rödder weist auf einen schmerzhaften Paradoxon hin: Die AfD sei paradoxerweise eher stärker geworden, je höher die symbolische Brandmauer gezogen wurde.
Und auch Karl-Theodor zu Guttenberg meldet sich zu Wort. Er plädiert für eine inhaltliche Auseinandersetzung statt reiner moralischer Abgrenzung. Die Union müsse konservative Kernthemen wie Migration, Sicherheit oder Energiepolitik wieder programmatisch besetzen, anstatt sie kampflos der AfD zu überlassen.
Diese Signale aus der zweiten Reihe werden durch massive Erschütterungen aus den ostdeutschen Landesverbänden verstärkt. Andreas Bühl, CDU-Fraktionschef in Thüringen, betont, dass die Qualität eines Gesetzes nicht davon abhängen dürfe, wer im Parlament dafür oder dagegen stimmt. Tom Unger aus Sachsen warnt davor, sich von anderen “einmauern” zu lassen. Und Saskia Ludwig aus Brandenburg spricht sich offen für einen “normaleren parlamentarischen Umgang” aus und fordert, der AfD die ihr zustehenden Ausschussrechte und Funktionen zuzugestehen.
Die Zahlen geben dieser Debatte eine dramatische Dringlichkeit. Die Projektionen zeigen eine tiefe Ost-West-Spaltung. Im Osten würde die AfD auf rund 38 Prozent kommen, im Westen auf “nur” 24 Prozent. Während die Union im Westen knapp vor der AfD liegt, ist sie im Osten deutlich dahinter. In manchen Szenarien würden AfD und das BSW von Sahra Wagenknecht im Osten gemeinsam eine rechnerische Mehrheit der Mandate erreichen – CDU, SPD, Linke und Grüne blieben dahinter zurück. Politikwissenschaftler sehen darin den Hinweis auf eine neue politische Mitte in Ostdeutschland, die fundamental anders tickt als der Westen.
Das Vertrauen in die Brandmauer ist auch in der Bevölkerung nicht mehr unumstritten. Zwar will knapp die Hälfte der Befragten, dass die Union daran festhält, ein großer Teil ist jedoch mittlerweile dagegen. Mehr als zwei Drittel der Menschen erwarten laut Umfragen, dass es in den kommenden Jahren mindestens eine von der AfD geführte Landesregierung geben wird.
Zu all dem gesellt sich eine juristische und finanzielle Gemengelage, die die Krise weiter befeuert. Das 500-Milliarden-Sondervermögen für Infrastruktur wird vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) kritisiert, da ein Teil der Mittel faktisch nur bestehende Ausgaben ersetze, statt zusätzliche Investitionen zu ermöglichen – ein “Etikettenschwindel”, wie Kritiker sagen.

Noch explosiver ist jedoch die Frage, ob der Bundestag überhaupt korrekt zusammengesetzt ist. Hintergrund ist das hauchdünne Scheitern des BSW, das mit nur 9.500 Stimmen an der Fünf-Prozent-Hürde vorbeigeschrammt sein soll. Vertreter von BSW und AfD fordern nun eine umfassende Neuauszählung. Der AfD-Politiker Stefan Brandner argumentiert, in einer Demokratie müsse die Korrektheit des Ergebnisses Vorrang vor parteipolitischem Eigeninteresse haben. Sollte sich herausstellen, dass dem BSW zusätzliche Mandate zustehen, könnte das die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag fundamental verändern – bis hin zu der Frage, ob die Regierungsmehrheit von Friedrich Merz überhaupt noch besteht.
Die Kombination aus katastrophalen Zustimmungswerten, innerparteilichen Revolten, strukturellen Finanzproblemen und einem massiven Zuspruch für die Oppositionsparteien schafft ein Klima, das viele als politischen Ausnahmezustand empfinden. Friedrich Merz steht mit dem Rücken zur Wand. Gelingt es seiner Regierung nicht, in zentralen Bereichen wie der Migration – die von den Bürgern als wichtigste Aufgabe genannt wird – sichtbare Ergebnisse zu liefern, scheint sein Schicksal besiegelt. Die Diskussion darüber, wer dieses Land künftig führen soll, hat gerade erst begonnen. Und Neuwahlen sind längst keine ferne Utopie mehr, sondern eine reale, vielleicht sogar wahrscheinliche Option.