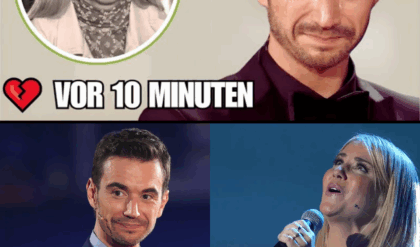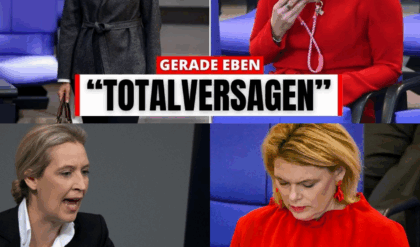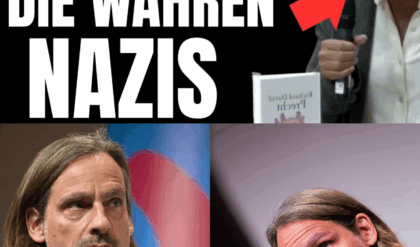Von unserer Korrespondentin für Innenpolitik
In einer der schärfsten und emotional aufgeladensten Reden der jüngeren Vergangenheit hat Alice Weidel, Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, die deutsche Bundesregierung frontal attackiert und ihr ein „stümperhaftes“ Versagen in der Friedenspolitik und der Wahrung deutscher Interessen attestiert. Die Politikerin nutzte ein aktuelles Statement, um ein düsteres Bild vom Zustand der deutschen Diplomatie zu zeichnen, die in ihren Augen auf internationaler Bühne degradiert wurde. Gleichzeitig wetterte sie mit Entsetzen gegen die aktuellen Überlegungen zur Wiedereinführung einer Art Wehrpflicht per Losverfahren, die junge Deutsche in einen Krieg an Europas Ostgrenze schicken könnte. Die Quintessenz ihrer Abrechnung ist ein vernichtendes Urteil: Deutschland spiele unter dieser Regierung keine Rolle mehr, und die Hoffnung auf Frieden ruhe nun auf externen Akteuren – allen voran dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump.

Der Trump-Kontrast: Frieden durch Fakten statt deutschem Stillstand
Weidel begann ihre Ausführungen mit einer bemerkenswerten Anerkennung, die in der deutschen Politiklandschaft Seltenheitswert hat: Sie würdigte Donald Trump für seinen Erfolg bei der Aushandlung der Freilassung israelischer Geiseln. Diesen Moment des Friedens bezeichnete sie als „großartig“ und stellte fest, dass Trump ein Mann sei, „der Fakten schafft“. Dieses Lob diente als direkter Kontrast zur deutschen Außenpolitik und als ein rhetorisches Mittel, um jene Kritiker zu „lügen“ zu strafen, die Trump in der Vergangenheit „runtergeredet und runtergeschrieben“ hätten.
Die positive Nennung Trumps ist dabei mehr als nur eine Randnotiz; sie ist der Schlüssel zu Weidels zentraler These: Die traditionellen europäischen Mächte, allen voran Deutschland, sind diplomatisch gelähmt, unfähig, eigene Friedensinitiativen zu starten, und müssen hilflos zusehen, wie globale Ordnungsmächte außerhalb Europas – oder eben ein Außenseiter wie Trump – die Initiative ergreifen. Es ist die Anklage gegen eine Bundesregierung, die es versäumt hat, in den entscheidenden Momenten als souveräner Akteur aufzutreten.
Die diplomatische Demütigung: Zaungäste neben der Toppflanze
Der schmerzhafteste Teil ihrer Kritik zielte auf die offensichtliche Degradierung Deutschlands auf dem internationalen Parkett ab. Weidel verwies auf das Schicksal von Vertretern der deutschen Bundesregierung, die bei wichtigen internationalen Treffen lediglich den Status von „Zaungästen“ innehatten. Als besonders anschauliches und demütigendes Beispiel führte sie Friedrich Merz, den Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, an. Merz habe in Sharm el-Sheikh „alleine rumgestanden, keiner mit dem reden will“ und sei in der letzten Reihe „neben einer Toppflanze platziert“ worden.
Diese Anekdote – ob wörtlich zu nehmen oder als sinnbildliche Überhöhung der deutschen Isolation – ist ein rhetorisch starkes Bild für den diplomatischen Abstieg. Es visualisiert das Gefühl der Irrelevanz: Die einstige Führungsmacht Europas ist auf den Status eines politischen Statisten reduziert, eines unbeachteten Akteurs, der an den Rand der Verhandlungen gedrängt wird. Weidel macht klar, dass dieser Verlust an internationalem Ansehen die direkte Folge der aktuellen Regierungsarbeit sei und nicht nur eine Peinlichkeit, sondern ein substanzieller Schaden für die deutschen Interessen darstelle. „Wir spielen keine Rolle mehr unter dieser Regierung. Wir sind absolut degradiert,“ so ihr schonungsloses Fazit.
Die fehlende Initiative im Gaza-Konflikt, wo sich die Bundesregierung nach ihrer Darstellung lediglich auf parteipolitische Bekundungen beschränkte, während sie eigene Vorschläge für einen Frieden schuldig blieb, verfestigt dieses Bild der politischen Lähmung. Weidel hätte sich „Initiativen für den Frieden im Gaza gewünscht“, die jedoch „alles ausgeblieben“ seien. Die Botschaft ist eindeutig: Die deutsche Politik ist in ideologischen Grabenkämpfen gefangen und verliert die Fähigkeit, pragmatisch und wirksam auf globale Krisen zu reagieren.

Der Ruf nach Frieden im Osten: Hoffnung auf Trump und Putin
Die Kritik an der Außenpolitik gipfelt in der Forderung nach einem aktiveren Engagement für einen Friedensplan im Ukraine-Krieg. Weidel sprach explizit im Namen der gesamten AfD-Bundestagsfraktion, als sie sich „deutlich mehr Initiative für einen Friedensplan für die Ukraine“ wünschte, um das „sinnlose Sterben zu beenden“. Auch hier konstatiert sie ein komplettes Versagen der Bundesregierung.
Dieses Versagen führt sie zu einer sehr persönlichen und zugleich politisch brisanten Äußerung: „Das ist meine ganz persönliche Hoffnung… meine persönliche Hoffnung auf den amerikanischen Präsidenten hier einen Friedensplan herbeizuführen.“ Die Tatsache, dass eine führende deutsche Oppositionspolitikerin ihre persönliche Hoffnung zur Beendigung eines europäischen Krieges auf den potenziellen nächsten US-Präsidenten, Donald Trump, projiziert, und nicht auf die eigene Regierung oder die europäischen Partner, unterstreicht das tiefe Misstrauen in die deutsche Führung. Die Bundesregierung werde, so die implizite Anklage, ihrer Verantwortung nicht gerecht und überlässt die entscheidenden Fragen von Krieg und Frieden externen Mächten. Gleichzeitig appelliert Weidel auch an Wladimir Putin, „einlenkt und ebenfalls eine Initiative für Frieden in der Ukraine zeigt“, womit sie die Notwendigkeit einer beidseitigen Deeskalation betont.
Die Angst vor der Einberufung: Schwachsinn und Grausamkeit
Der emotionalste und wohl schockierendste Teil der Rede betraf die aktuellen Diskussionen über die Wiedereinführung einer Art Wehrpflicht per Losverfahren – ein Thema, das in den letzten Wochen in der politischen Debatte aufgekommen war. Weidel verurteilte diese Überlegungen mit einer ungeschminkten Härte, die auf tief sitzender Sorge fußt. Sie warnte davor, dass die Bundesregierung „auf interessante Ideen kommt, also eigentlich auf unverantwortliche Ideen“, indem sie mit dem Gedanken spiele, „unsere Söhne, Kinder, Ehemänner in diesen Krieg zu schicken und das am besten noch per Losverfahren“.
Ihr Urteil über diesen Vorschlag ist vernichtend und kompromisslos: „Ich habe so etwas, so so etwas Schwachsinniges selten gehört.“ Die Einführung eines solchen Systems in Deutschland, das historisch vor allem aus dem Vietnamkrieg bekannt ist, empfindet sie als einen zutiefst gefährlichen und moralisch fragwürdigen Schritt. Die Idee, über das Schicksal junger Menschen per Zufallsprinzip zu entscheiden und sie in einen blutigen Konflikt zu senden, den die deutsche Politik selbst nicht beenden kann, empört sie zutiefst.
Ihre Empörung gipfelt in einem provokanten Wunsch, der die Brisanz des Themas unterstreicht: „Hoffentlich trifft es Herrn Klingbeile“, sowie „all diejenigen, die hier diesen Krieg wollen und weiterführen wollen“. Dieser Wunsch ist Ausdruck einer tiefen Verzweiflung und des rhetorischen Versuchs, die Befürworter einer weiteren Eskalation mit den realen Konsequenzen ihrer Politik zu konfrontieren: „um einfach mal zu sehen, was so ein Krieg bedeutet“. Es ist die Forderung nach einer persönlichen Betroffenheit jener politischen Elite, die ihrer Meinung nach leichtfertig über das Schicksal junger Männer entscheidet.
Der Schandfleck in der Geschichte: Deutsche Panzer gegen Russland
Weidel verknüpfte die Gefahr der Einberufung mit einer historischen und moralischen Anklage gegen die deutsche Unterstützung des Ukraine-Krieges. Ihre Beschreibung des Konflikts ist grafisch und brutal, entworfen, um die Grausamkeit des Stellvertreterkrieges zu verdeutlichen: „Dieser Krieg ist dreckig. Er ist unsinnig. Es ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.“ Sie spricht von „fast noch Kinder[n], junge Männer[n], die dort verfeuert werden“, die „in Schlammlöchern sitzen“ und in „Schutzengräben“ kämpfen. Das Bild des eingegrabenen Infanteristen, der gezwungen ist, seinen Gegner auf der jeweils anderen Seite umzubringen, bezeichnet sie als „so primitiv und oldkultiviert“.
Die Unterstützung dieses Krieges durch die deutsche Bundesregierung, insbesondere die Lieferung und der Einsatz deutscher Panzer gegen Russland, wird von ihr als eine historische und moralische Katastrophe gewertet: „Das wir uns so etwas erlauben und so etwas unterstützen als deutsche Bundesregierung ist eine Schande, ist ein Schandfleck in unserer Geschichte.“ Die Tatsache, dass „deutsche Panzer gegen Russland rollen“, sei „geschichtsvergessen“.
Diese Aussage trifft das historische Mark der deutschen Nachkriegsidentität, die sich auf Deeskalation und Verantwortung stützt. Weidel reißt diese Wunde auf und argumentiert, dass die Bundesregierung durch ihre Entscheidungen die Lehren der Geschichte ignoriere und Deutschland in eine neue, gefährliche Konfrontation mit Russland führe, die die historische Schuld unnötig kompliziere. Für sie gibt es nur eine Konsequenz: „Wir müssen die Initiative zeigen, diesen schrecklichen Krieg so schnell wie möglich zu beenden.“
Fazit: Die Hoffnung ruht auf externen Mächten
Am Ende ihrer Rede zog Alice Weidel eine bittere Bilanz: „Ich habe jegliche Hoffnungen in diese stümperhafte Regierung aufgegeben.“ Die Bundesregierung besitze weder den „politischen Willen“ noch die „Kompetenzen“, um eine Wende im Sinne Deutschlands, Europas oder der Ukraine herbeizuführen.
Das Resultat dieser festgestellten Inkompetenz ist eine existenzielle Verlagerung der Hoffnung: „Dementsprechend, ja, bleibt die Hoffnung auf den Amerikanern.“ Weidels Statement ist somit mehr als nur eine parteipolitische Attacke; es ist eine tief pessimistische Bestandsaufnahme der deutschen Politik. Es zeichnet das Bild einer Nation, deren Führung in den Augen der Kritiker so versagt hat, dass die wichtigsten Fragen von Krieg, Frieden und nationaler Sicherheit nicht mehr in Berlin gelöst, sondern von Akteuren jenseits des Atlantiks erwartet werden. Der Kontrast zwischen dem Triumph Trumps bei der Geiselfreilassung und der Demütigung deutscher Vertreter neben dem Topfbaum ist das Symbol für eine Außenpolitik, die in eine tiefe Krise geraten ist. Es ist ein Weckruf an Deutschland, sich seiner Rolle bewusst zu werden und nicht nur als willfähriger Partner, sondern als selbstbewusster, friedensorientierter Akteur auf der Weltbühne aufzutreten – bevor die unverantwortlichen Pläne zur Einberufung junge Männer in einen Krieg schicken, den die Politik nicht beenden will oder kann.