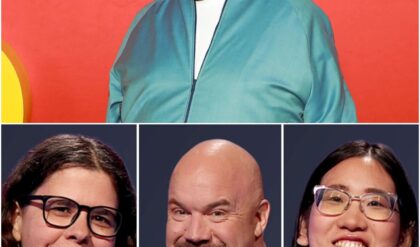Deutschland, eine Nation, die stolz auf ihre demokratischen Traditionen ist, sieht sich mit einer beispiellosen und zutiefst verstörenden Forderung konfrontiert. Was als akademische Gedankenspiele in einem öffentlich-rechtlichen Funknetzwerk begann, hat sich zu einem potenziellen Sprengstoff für die gesamte politische Landschaft entwickelt. Die Rede ist von der Idee, Menschen in den letzten 18 Jahren ihres Lebens das Wahlrecht zu entziehen. Geäußert wurde diese schockierende These von niemand Geringerem als Marcel Fratzscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Eine Forderung, die nicht nur für ungläubiges Staunen sorgt, sondern auch die Grundfesten der Gerechtigkeit und Würde einer alternden Gesellschaft in Frage stellt.
Auf den ersten Blick mag die Idee absurd erscheinen. Doch gerade ihre Absurdität macht sie so gefährlich. Fratzscher argumentiert mit einer scheinbar logischen Prämisse: Wenn junge Menschen erst ab 18 wählen dürfen, warum sollten ältere, die bald sterben, noch wählen? Dieser vermeintlich rationale Vergleich entbehrt jeglicher menschlicher Logik. Denn er stellt eine der grundlegendsten Fragen, die unsere Gesellschaft definieren: Wer bestimmt, wann ein Leben „nutzlos“ genug ist, um es von den demokratischen Prozessen auszuschließen? Die implizite Botschaft ist klar: Die Stimme der Alten zählt weniger.

Das erste und offensichtlichste Problem ist die unmögliche Umsetzung. Wer soll entscheiden, wann jemand die letzten 18 Jahre seines Lebens erreicht hat? Gibt es eine geheime statistische Formel, die uns sagt, dass ein 41-Jähriger wie Oli nur noch 18 Jahre zu leben hat? Und was passiert, wenn jemand plötzlich und unerwartet stirbt? Hätte diese Person dann unwissentlich seit Jahren kein Wahlrecht mehr gehabt? Der Vorschlag ist nicht nur unpraktikabel, er ist auch zutiefst menschenverachtend, weil er die Vorhersagbarkeit des Todes als Instrument der politischen Kontrolle missbraucht. Die Idee, Standardwerte für die Lebenserwartung heranzuziehen, wie es in der Diskussion angedeutet wird, ist ebenso hanebüchen. Würde man statistisch festlegen, dass ein Mensch durchschnittlich 82 Jahre alt wird, wäre das Wahlrecht ab 64 Jahren Geschichte. Ein solcher Mechanismus wäre nicht nur ungerecht, sondern auch ein massiver Eingriff in die persönliche Freiheit und die Würde jedes Einzelnen.
Doch die wahre Brisanz des Vorschlags liegt in seinen möglichen politischen Konsequenzen. Denn eine solche Regelung würde das Machtgefüge der deutschen Politik radikal verschieben. Die statistische Erhebung zur Bundestagswahl 2021 zeigt, dass fast 40 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland über 60 Jahre alt sind. Das sind Millionen von Stimmen, die plötzlich verschwinden würden. Eine solche Verschiebung wäre nicht nur signifikant, sie wäre wahlentscheidend.
Und hier wird es besonders interessant für die verschiedenen Parteien. Wer wählt hauptsächlich die SPD? Richtig, die Wähler ab 60 Jahren aufwärts. Dieselbe Kohorte, die nach Fratzschers Vorstellung das Wahlrecht verlieren würde. Auch die Union profitiert stark von Wählern dieser Altersgruppe, wie die Wahlstatistiken zeigen. Über 40 Prozent der Wähler sind 60 Jahre und älter. Ein Wahlrechtsentzug würde diese Parteien hart treffen und ihr Stimmenreservoir massiv reduzieren. Die Grünen würden von einer solchen Änderung profitieren. Während ihr Anteil bei den Älteren zwar signifikant ist, ist er bei den jüngeren Wählern höher. Bei der FDP würde sich das Wählerverhalten kaum verändern, sie bliebe weiterhin eine Kleinpartei.
Die vielleicht größte und für Fratzscher wahrscheinlich unerwartete Konsequenz betrifft die AfD. Die Wahlstatistik zeigt, dass die AfD bei Wählern ab 60 Jahren nur sehr wenig Unterstützung genießt. Im Gegenzug ist ihr Stimmenanteil in der Altersgruppe von 18 bis 59 Jahren deutlich stärker. Würde man die ältere Bevölkerung vom Wahlrecht ausschließen, würde die AfD im Verhältnis deutlich an Stimmen gewinnen. Es könnte sogar dazu führen, dass die Partei die Sperrminorität im Bundestag erreicht, was ihr weitreichende Blockademöglichkeiten verschaffen würde. In den Landtagen wäre es sogar möglich, dass sie eine absolute Mehrheit erringt.

Diese politischen Konsequenzen sind nicht nur hypothetisch, sondern basieren auf harten Fakten. Es stellt sich die Frage, ob Fratzscher diese Auswirkungen bedacht hat oder ob er mit seinem Vorschlag unbewusst eine Lawine lostritt, deren Ende unabsehbar ist.
Es ist nicht das erste Mal, dass Fratzscher mit kontroversen Ideen aufwartet. Im August schlug er vor, dass „Boomer“ – also die geburtenstarken Jahrgänge – ein soziales Pflichtjahr leisten müssten, weil sie zu wenige Kinder bekommen hätten. Eine weitere absurde Vorstellung, die die Rentner zu Zwangsarbeitern machen würde. Er forderte auch, Rentner in sozialen Einrichtungen oder der Verteidigung einzusetzen. Solche Vorschläge, so skurril sie auch klingen mögen, sind Teil einer größeren Debatte über die vermeintliche Funktionsunfähigkeit des Generationenvertrags, der angeblich immer mehr auf Kosten der Jüngeren gehe.
Der Gedanke dahinter ist, dass die ältere Generation überproportional von staatlichen Leistungen profitiere, ohne einen entsprechenden Beitrag zu leisten. Dies führt zu einer gefährlichen Rhetorik, die Alt gegen Jung ausspielt und die soziale Solidarität untergräbt. Dabei werden die realen Probleme unserer alternden Gesellschaft völlig außer Acht gelassen. Es ist die gleiche Logik, die hinter der Forderung steht, dass Menschen bis 73 arbeiten sollen, obwohl dies für viele körperlich gar nicht machbar ist. Die Folge sind Abschläge von der Rente und Altersarmut, eine Realität, auf die der Staat nur unzureichende Antworten hat.
Die Tatsache, dass solche Ideen von hochrangigen Persönlichkeiten wie Fratzscher geäußert werden, ist alarmierend. Besonders, wenn man bedenkt, dass sein Institut, das DIW, zu 50 Prozent vom Bund und zu 50 Prozent von den Ländern gefördert wird. Es ist ein beunruhigendes Zeichen, dass derartige Gedankenspiele im öffentlichen Raum salonfähig gemacht werden. Es zeigt, dass eine neue Art von politischer Verantwortungslosigkeit Einzug hält, die die Grundlagen unserer Gesellschaft zu untergraben droht.
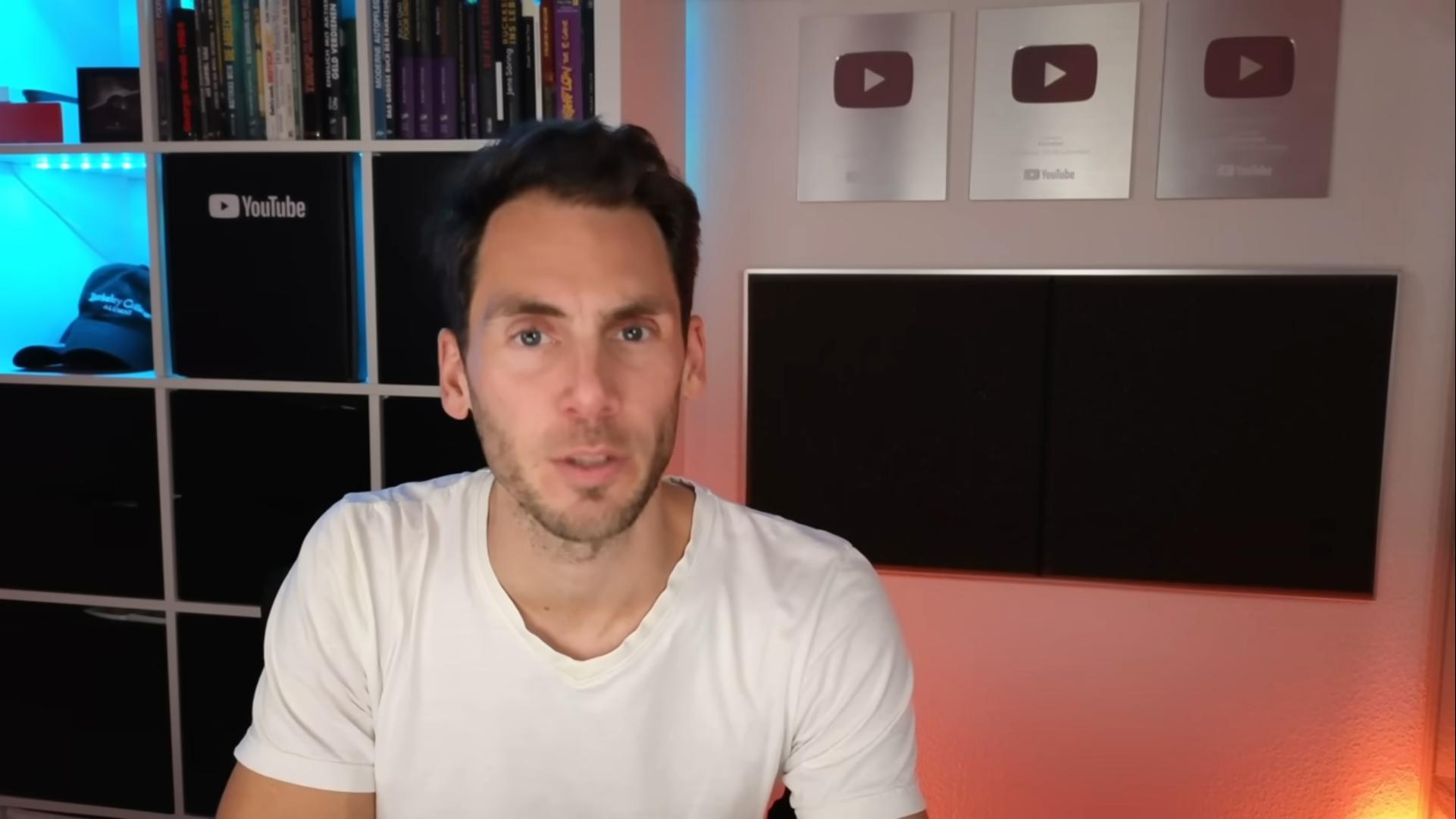
In dieser sich verändernden Welt ist Eigenverantwortung wichtiger denn je. Wie im Video betont, muss jeder Einzelne über seine eigene Zukunft nachdenken und sich finanziell absichern. Es ist ein Weckruf, sich nicht von Politikern und selbsternannten Experten an der Nase herumführen zu lassen, die mit radikalen Ideen die Gesellschaft spalten. Investitionen in Aktien und ETFs können eine Möglichkeit sein, sich auf eine Zukunft vorzubereiten, in der der Staat möglicherweise nicht mehr in der Lage ist, die gewohnten Sicherheiten zu gewährleisten. Es ist ein Akt der Selbstermächtigung in einer Zeit, in der die Stimmen der Vernunft oft im Lärm der Provokation untergehen.