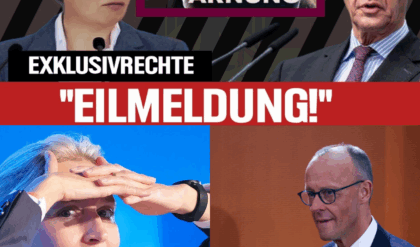Die jüngste Ausgabe der ARD-Talkshow „Hart aber fair“ hat eine hitzige Debatte ausgelöst, die weit über die Studiotore hinaus Wellen schlägt. Im Zentrum der Diskussion stehen Forderungen nach einer stärkeren Regulierung und Zensur sozialer Medien, gepaart mit einem bemerkenswerten Selbstlob der öffentlich-rechtlichen Sender. Besonders ins Auge stach dabei der Auftritt der ehemaligen ZDF-Moderatorin Petra Gerster, deren Äußerungen die Frage aufwerfen, inwieweit die Meinungsfreiheit in Deutschland unter Druck gerät.

Gersters Statement, dass es „völlig undenkbar“ sei, dass öffentlich-rechtliche Medien eine Lüge veröffentlichen, ohne sofort zur Rechenschaft gezogen zu werden, wurde von vielen als naives Eigenlob oder gar als Bewerbung um einen neuen Posten interpretiert. Sie betonte die Strenge des deutschen Medienrechts und die Notwendigkeit, „Monopolbildung [zu] verhindern“. Ihre Kritik richtete sich explizit gegen „fünf Monopole aus den USA“, die uns mit „ihrem Dreck überfluten“. Diese emotional aufgeladenen Worte, die an Steve Bannons berüchtigte Aussage „Fleet the scene with shit“ erinnerten, zielten darauf ab, eine stärkere Regulierung von Inhalten zu fordern, insbesondere zum Schutz von Kindern. Gerster argumentierte, dass „Desinformation“ und „Hass und Hetze“ – Begriffe, die sie auch auf kritische Berichterstattung über öffentlich-rechtliche Medien anwenden würde – konsequent entfernt und verboten werden müssten.
Diese Haltung steht jedoch im krassen Widerspruch zu jüngsten Erfahrungen, in denen gerade öffentlich-rechtliche Medien selbst wegen fragwürdiger Berichterstattung in die Kritik geraten sind. Als Beispiel werden Berichte von Elmar Theveßen im Bezug auf Charlie Kirk genannt, oder auch Fälle, in denen Apollo News eine Gegendarstellung vom ZDF erwirkte. Die Behauptung der „Undenkbarkeit“ einer Falschmeldung wirkt vor diesem Hintergrund zumindest fragwürdig, wenn nicht sogar realitätsfern.
Gersters Forderung nach weitreichenden Konsequenzen für „rechtswidrige Inhalte“ auf Social Media ging noch weiter. Sie forderte explizit, dass Plattformen nicht nur bei rechtswidrigen Inhalten, sondern auch bei „Mysogenie, also Herabsetzung von Frauen, Frauenverachtung, Rassismus, Antisemitismus – all das, da muss verboten werden. Keine Meinungsfreiheit!“ Diese radikale Position, die scheinbar jegliches Ansprechen von Fakten oder der Realität, wie die Existenz von nur zwei Geschlechtern, verbieten möchte, löste bei vielen Zuschauern Unbehagen aus.

Einige Gäste in der Sendung, wie die CDU-Politikerin Christina Schröder, wagten es, zaghaft die Meinungsfreiheit zu verteidigen. Sie sprach die Hausdurchsuchungen an, die wegen vermeintlich „schwachköpfiger“ Posts über Robert Habeck stattfanden, und betonte, dass die Grenzen zwischen strafbaren und nicht strafbaren Inhalten fließend seien. Doch ihre Stimme schien in der allgemeinen Forderung nach mehr Zensur unterzugehen.
Die einhellige Meinung in der Runde, abgesehen von Schröders zaghaften Versuchen, war, dass Meinungsfreiheit ein Relikt der Vergangenheit sei und „mehr Zensur gewagt“ werden müsse, um „richtig gute Demokraten“ zu sein. Der Tiktoker und ARD-Podcaster Levi Penell plädierte für eine „menschliche Perspektive“ und die Löschung von Inhalten, die ihm nicht gefallen. Diese subjektive Herangehensweise, bei der persönliches Missfallen zum Maßstab für Zensur erhoben wird, birgt erhebliche Gefahren für eine offene Gesellschaft.
Der Rechtsanwalt Chan beklagte zudem, dass der Digital Service Act (DSA), ein „drakonisches EU-Zensurgesetz“, nicht „richtig angewendet“ werde. Dies deutet darauf hin, dass die bereits bestehenden Mechanismen zur Inhaltskontrolle einigen noch nicht weit genug gehen. Ein pinkhaariger Lehrer stimmte dem zu und argumentierte, dass wir „keine Angst [haben] zur vor zu viel Regulation, weil wir ganz eindeutig zu wenig regulieren“. Er führte als Beleg die „ganzen rechtsextremen Codes“ an, die sich angeblich im Raum befänden, was die Emotionalität und die fehlende Differenzierung in der Debatte weiter unterstrich.
Die Diskussion bei „Hart aber fair“ offenbart eine gefährliche Tendenz: Im Namen des Schutzes vor Desinformation und Hassreden wird zunehmend die Meinungsfreiheit geopfert. Die Forderung nach Zensur, auch bei Inhalten, die nicht eindeutig strafbar sind, sondern lediglich als „Mysogenie“, „Frauenverachtung“ oder „Rassismus“ empfunden werden, ohne klare rechtliche Definitionen, öffnet Tür und Tor für Willkür. Wenn subjektives Missfallen oder eine „menschliche Perspektive“ die Richtschnur für die Löschung von Inhalten werden, droht eine Verengung des öffentlichen Diskurses, die einer demokratischen Gesellschaft nicht dienlich ist.

Es ist eine Ironie, dass ausgerechnet in einer Sendung, die den Anspruch hat, fair und ausgewogen zu sein, solche weitreichenden Forderungen nach Einschränkung der Meinungsfreiheit mit so wenig Widerspruch hingenommen werden. Die Debatte zeigt, dass die Gesellschaft vor der Herausforderung steht, einen Weg zu finden, um mit Desinformation umzugehen, ohne dabei die fundamentalen Rechte auf freie Meinungsäußerung zu untergraben. Die Gefahr besteht, dass im Eifer des Gefechts die Meinungsfreiheit, ein Eckpfeiler unserer Demokratie, zum Kollateralschaden wird. Die Frage, wer entscheidet, was „Dreck“ ist und was nicht, und wer die Macht hat, Inhalte zu verbieten, bleibt beunruhigend offen. Die Sendung hat damit nicht nur eine Debatte angestoßen, sondern auch ein besorgniserregendes Bild über den Zustand der Meinungsfreiheit in Deutschland gezeichnet.