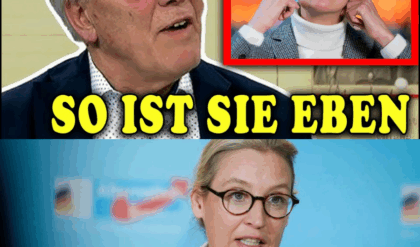Der Lanz-Eklat: Wagenknechts NATO-These spaltet die Nation – Warum eine Aussage den medialen Wahnsinn auslöst

Es gibt Momente im deutschen Fernsehen, die wie ein Funke in ein Pulverfass wirken. Momente, die über Nacht viral gehen, die Tausende von Kommentaren provozieren und die eine tiefe, schwelende Spaltung in der Gesellschaft offenlegen. Ein solcher Moment ereignete sich kürzlich in der Talkshow von Markus Lanz. Die Protagonistin: Sahra Wagenknecht. Ihre Waffe: Ein einziger Satz, der das gesamte westliche Narrativ über den Ukrainekrieg infrage stellt.
Ein Clip dieser Szene, der inzwischen auf diversen Plattformen kursiert, hat innerhalb von Stunden Hunderttausende Aufrufe generiert. Es ist ein Phänomen, das zeigt: Wagenknecht hat einen Nerv getroffen. Doch was genau hat sie gesagt, das einen derartigen „medialen Wahnsinn“ und einen „riesigen Aufschrei“ auslösen konnte?
In der hitzigen Debatte bei Lanz, umgeben von Gesichtern, die meist die etablierte Linie der deutschen Außenpolitik vertreten, tat Wagenknecht, was sie am besten kann: Sie provozierte. Sie dekonstruierte die gängige Lesart des Konflikts mit einer bestechend einfachen, aber hochbrisanten These. Statt die Motive Moskaus auf reine Aggression zu reduzieren, legte sie den Finger in eine andere Wunde. Der Kern des Problems, so Wagenknecht, sei ein anderer: Es gehe darum, „Natomilitär in der Ukraine zu verhindern“.
Es ist ein Satz, der im Studio für eisiges Schweigen und ungläubiges Kopfschütteln sorgt, der aber außerhalb der Fernsehkameras von Tausenden geteilt und beklatscht wird. Warum? Weil er die fundamentale Frage nach der Ursache des Krieges stellt – eine Frage, die in der öffentlichen Debatte oft als tabu gilt.
Die offizielle Erzählung, die von Berlin über Brüssel bis Washington konsistent vertreten wird, ist klar: Der 24. Februar 2022 war ein Akt unprovozierter, imperialistischer Aggression. Ein Angriff auf die Souveränität eines Landes und auf die europäische Friedensordnung. In dieser Lesart ist die NATO ein reines Verteidigungsbündnis, dem beizutreten das souveräne Recht der Ukraine ist. Wer etwas anderes behauptet, so der unausgesprochene Vorwurf, betreibt „Putin-Propaganda“.
Und genau hier setzt Wagenknecht an. Sie bricht dieses Tabu. Sie wagt es, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen die Perspektive der Gegenseite zu artikulieren – nicht, um sie zu rechtfertigen, aber um sie als Motiv zu benennen. Sie konfrontiert die deutsche Öffentlichkeit mit der Tatsache, dass die Ausdehnung der NATO nach Osten von Russland seit Jahrzehnten als existentielle Bedrohung und als Bruch von Versprechen wahrgenommen wird.
Dieser Aspekt – die Rolle der NATO – ist der wunde Punkt in der westlichen Argumentation. Selbst wenn man Wagenknechts Zuspitzung nicht folgt, lässt sich kaum leugnen, dass die Vorstellung einer Ukraine als NATO-Mitglied, mit US-Raketen an der russischen Grenze, die Situation „massiv noch mal angeheizt“ hat, wie es selbst zurückhaltende Kommentatoren zugeben. Es ist eine Tatsache, die in der täglichen Berichterstattung über den heroischen Verteidigungskampf der Ukraine oft untergeht, aber in den Köpfen vieler Menschen präsent ist.
Der „mediale Wahnsinn“, der auf Wagenknechts Äußerungen folgt, ist bezeichnend. Er zeigt die Verengung des Meinungskorridors. Anstatt ihre These – die NATO-Expansion als Kriegsgrund – sachlich zu debattieren und historisch einzuordnen, folgt oft der moralische Aufschrei. Sie wird als Verräterin gebrandmarkt, als jemand, der Täter und Opfer verwechselt. Doch dieser Aufschrei übertönt die Frage nicht. Er macht sie nur lauter.

Wagenknecht stößt in ein Vakuum, das die etablierten Parteien und Medien selbst geschaffen haben. Während die Regierung von einer „Zeitenwende“ spricht und ein 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr auflegt, während Waffenlieferungen als alternativlos dargestellt werden, wächst in einem Teil der Bevölkerung das Unbehagen. Es ist die Angst vor einer Eskalation, die Sorge um die wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen und das dumpfe Gefühl, dass der Preis für die „Verteidigung unserer Freiheit am Hindukusch“ – oder eben jetzt in der Ukraine – von den Falschen bezahlt wird.
Diese Menschen fühlen sich von der aktuellen Politik nicht repräsentiert. Sie sehen eine mediale Landschaft, in der abweichende Meinungen kaum noch Platz finden. Für sie ist Sahra Wagenknecht eine der wenigen Stimmen, die ihre Sorgen artikuliert. Wenn sie bei Lanz sitzt, sehen sie nicht nur eine Politikerin; sie sehen einen Stellvertreterkrieg in einer Talkshow.
Die Frage, die im Raum steht und die der virale Clip unbeantwortet lässt, ist die quälendste: „Hat Vorwagenknecht recht mit dem was sie hier sagt oder Irrt sie?“.
Die Wahrheit ist, wie so oft, kompliziert. Die Reduzierung eines derart komplexen Krieges auf einen einzigen Grund – sei es Putins Imperialismus oder die NATO-Provokation – wird der Realität nicht gerecht. Natürlich ist Russlands Handeln ein klarer Bruch des Völkerrechts. Nichts rechtfertigt die Invasion, die Zerstörung von Städten und das unermessliche Leid.
Doch die Politik ist kein moralisches Seminar. Sie ist ein Spiel von Interessen, von Einflusssphären und von Sicherheitsbedenken – ob diese nun berechtigt sind oder nicht. Die Weigerung des Westens, Russlands Sicherheitsbedenken bezüglich der NATO ernst zu nehmen, ist ein historischer Fakt. Ob dies den Krieg unvermeidlich machte oder ob es nur ein willkommener Vorwand für einen lange gehegten Expansionsplan war, ist die eigentliche Streitfrage.
Sahra Wagenknecht hat sich klar positioniert. Sie glaubt an Ersteres. Sie ist überzeugt, dass der Westen eine Mitschuld trägt und dass ein Frieden nur möglich ist, wenn diese Mitschuld anerkannt und die Sicherheitsinteressen Russlands berücksichtigt werden. Für die einen ist das eine Kapitulation vor der Gewalt, für die anderen ist es die einzige realistische Position.
Der virale Erfolg ihres Auftritts zeigt, dass diese Debatte nicht länger unterdrückt werden kann. Die Menschen wollen Antworten. Sie sind es leid, eine einheitliche mediale Front vorgesetzt zu bekommen, während ihre eigenen Sorgen und Zweifel wachsen. Sie wollen die Frage diskutieren dürfen, ob die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine wichtiger ist als der Frieden in Europa.
Am Ende ist der Eklat bei Markus Lanz mehr als nur ein TV-Moment. Er ist ein Symptom für eine tiefe Zerrissenheit. Es ist der Kampf zweier Narrative, zweier Wahrheiten, die unvereinbar nebeneinanderstehen. Auf der einen Seite die moralische Gewissheit, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Auf der anderen Seite der pragmatische Zweifel, ob der eingeschlagene Weg der militärischen Konfrontation nicht in eine Katastrophe führt.
Sahra Wagenknecht mag mit ihrer Zuspitzung irren. Sie mag die Komplexität des russischen Neo-Imperialismus unterschätzen. Aber sie hat das unbestreitbare Verdienst, die entscheidenden Fragen öffentlich gestellt zu haben. Und der „riesige Aufschrei“, der darauf folgt, beweist nur, wie notwendig diese Debatte ist – auch wenn sie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht mehr stattfinden soll.