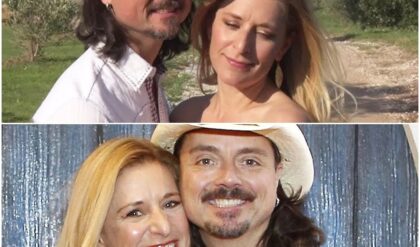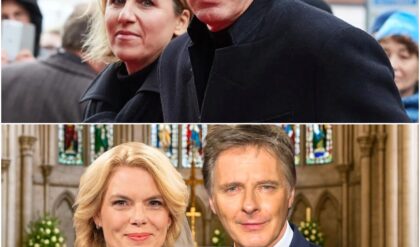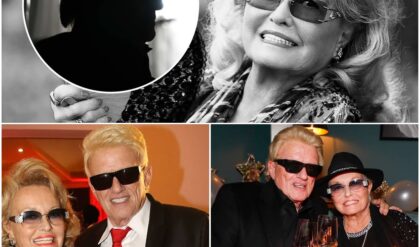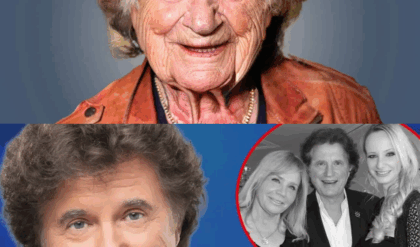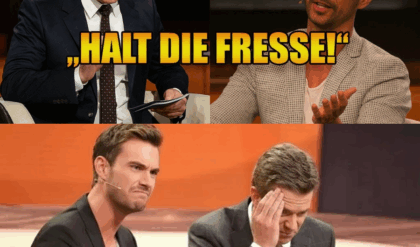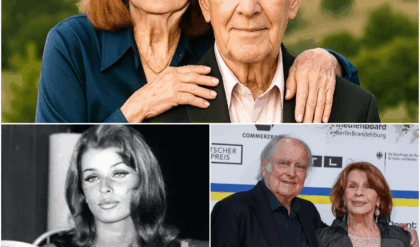Die Liste des Hasses: „Dosensuppe ohne Gehalt!“ – Harald Schmidt bricht sein Schweigen und enthüllt die fünf verachteten Feinde des deutschen Fernsehens
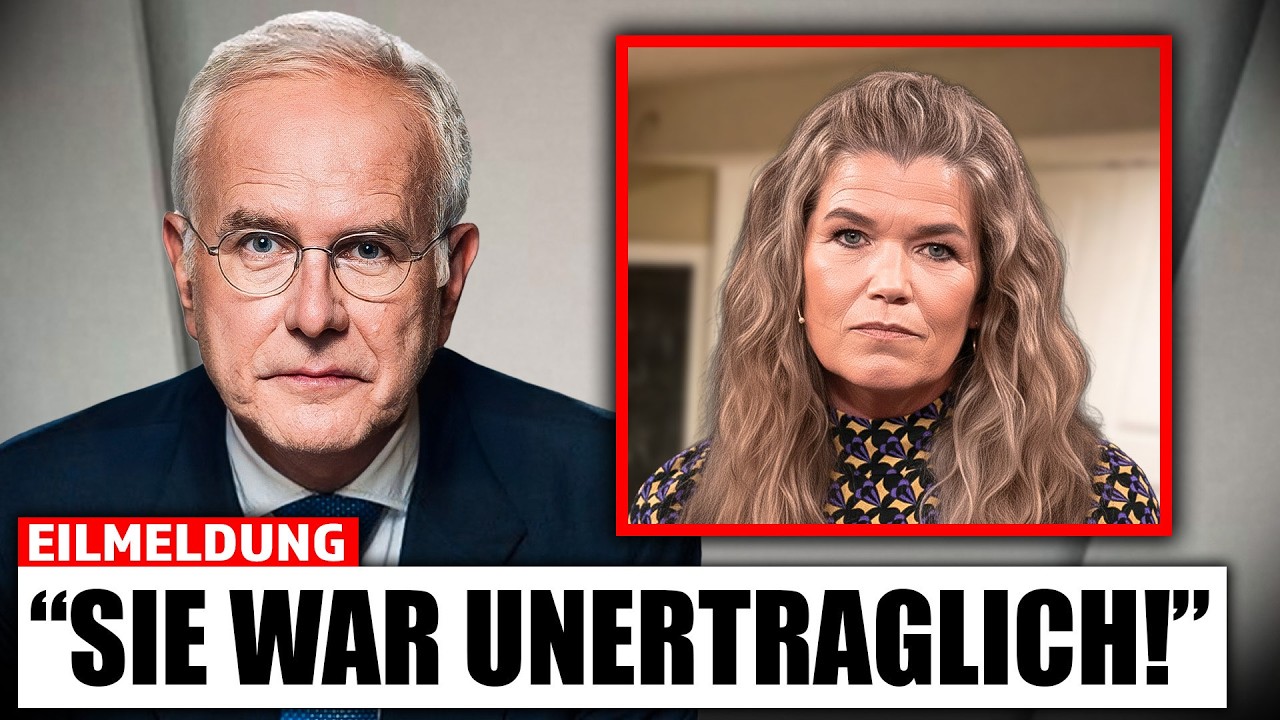
Mit 68 Jahren hat Harald Schmidt, der unangefochtene Papst der deutschen Late Night, ein tief sitzendes Schweigen gebrochen, das die Hallen der Republik in ihren Grundfesten erschüttert. Was sich nun offenbart, ist keine Nostalgie oder Altersmilde, sondern die gnadenlose Abrechnung eines Intellektuellen mit der medialen und kulturellen Elite, die er seit Jahrzehnten verachtet. In einer exklusiven Offenbarung nennt Schmidt die fünf deutschen Showgrößen, die er am meisten verachtet – eine Liste, die er als Mahnmal für die Irrtümer des modernen Fernsehens verstanden wissen will.
Diese fünf Namen stehen nicht nur für persönliche Feindschaften, sondern für eine tiefe philosophische Kluft zwischen Schmidts idealisierter, sarkastischer Distanz und der von ihm zutiefst abgelehnten Welt der Oberflächlichkeit, Effekthascherei und Sentimentalität. Die Liste ist ein Manifest der Verachtung, das die Mängel der Fernsehunterhaltung schonungslos auf den Punkt bringt: Eitelkeit, Oberflächlichkeit, Sentimentalität, Effekthascherei und Selbstinszenierung. Harald Schmidts Geständnis ist der kühle Blick eines Meisters auf die Schüler, die in seinen Augen versagt haben.
Kapitel I: Der Handwerker vs. Der Intellektuelle – Stefan Raab
Für Harald Schmidt verkörperte Stefan Raab, das Sinnbild des modernen Showmasters, genau das Gegenteil von allem, was er am Fernsehen liebte. Schmidt betrachtete Raab nicht als Künstler, sondern als einen „routinierten Handwerker“, dessen einziges Ziel es war, das Publikum zum Lachen zu bringen, aber nicht zum Nachdenken zu bewegen.
Der Zwist zwischen den beiden ungleichen Titanen begann, als Raab in seiner Sendung eine ganze Woche lang Spott über Schmidts angeblich angestaubten Humor goss. Raab ahmte Schmidts Bewegungen, seine charakteristischen Pausen und sogar seine Stimme nach, was Millionen amüsierte, Schmidt jedoch kein bisschen. Die Konfrontation gipfelte bei einer Gala, als Raab Schmidt entspannt ansprach und höhnte: „Na Harald, lange nichts mehr im Fernsehen? Schon fast vergessen“. Schmidt quittierte dies trocken: „Ich dich nie, leider“.
Die Feindschaft wurde endgültig besiegelt, als Raab Schmidt in einem Interview als „Denkmal, das allmählich verstaubt“ bezeichnete. Schmidt reagierte mit einem seiner berühmtesten Konter in einer Live-Sendung, der Raabs gesamte Arbeit auf ein Minimum reduzierte: „Rab macht Witze wie Dosensuppe – schnell erhitzt, aber ohne Gehalt!“. Bis heute herrscht zwischen den beiden absolute Funkstille. Sie repräsentieren zwei Welten, die einander nie verstehen wollten und es auch nie taten. Für Schmidt symbolisierte Raab den oberflächlichen Kommerz, der die intellektuelle Tiefe aus dem Fernsehen vertrieb.
Kapitel II: Die Fassade der Tiefe – Markus Lanz
Markus Lanz, der zweite auf Schmidts Liste, steht sinnbildlich für Disziplin, Selbstkontrolle und unermüdlichen Ehrgeiz – Eigenschaften, die Schmidt grundsätzlich respektierte, die er bei Lanz jedoch für eine bloße Fassade hielt. Schmidts Verachtung für Lanz entsprang der Wahrnehmung, dass Lanz’ präzise, beinahe schulmäßig gestellte Fragen eine gespielte Tiefgründigkeit verbargen, die jeder echten Sarkasmus zerbrechen ließ.
Das erste Zusammentreffen, bei dem Schmidt Lanz’ Fragen sarkastisch und überlegen kommentierte, empfand Lanz bereits als Angriff. Die Eskalation fand jedoch statt, als Schmidt als Gast in Lanz’ eigener Sendung angekündigt war. Schmidts Themenvorschlag an die Redaktion war lakonisch: „Mein Thema heißt Markus Lanz“. Trotz dieser Provokation fand das Gespräch statt und endete in einem Fiasco. Schmidt fiel Lanz wiederholt ins Wort, stellte Gegenfragen und kommentierte dessen Formulierungen live im Studio.
„Klingt, als hätten Sie das gerade auswendig gelernt“, höhnte Schmidt. Lanz versuchte gefasst zu bleiben, doch sein Lächeln gefror zusehends. Nach der Sendung soll Lanz frustriert geäußert haben: „Mit Harald kann man kein Interview führen, nur einen Schlagabtausch“. Schmidt konterte in einer Kolumne trocken, Lanz habe recht, „nur leider kam er unbewaffnet“. Seit diesem Tag meidet Lanz jedes öffentliche Wort über Schmidt. Für Schmidt ist die Schlussfolgerung klar und vernichtend: „Lanz ist der Typ, der Schweigen für Tiefgründigkeit hält“. Er sah in Lanz den Inbegriff des überambitionierten Routiniers, dem die wahre, intellektuelle Unbequemlichkeit fehlte.
Kapitel III: Die Frage der Authentizität – Hape Kerkeling
Die Feindschaft mit Hape Kerkeling ist besonders brisant, da sie aus gegenseitiger anfänglicher Wertschätzung entstand. Schmidt bewunderte Kerkelings Wandlungsfähigkeit und Bühnenpräsenz, doch Kerkeling verkörperte mit seiner Herzlichkeit und seinem Mitgefühl alles, was Schmidts ironische Distanz ablehnte.
Die Konfrontation, die die Bewunderung in Verachtung wandelte, ereignete sich in einer Talkshow. Kerkeling war eingeladen, über sein neues Buch zu sprechen, als Schmidt, der überraschend im Publikum saß, vom Moderator aufgefordert wurde, eine spontane Frage zu stellen. Schmidts Frage war eine philosophische Bombe, die an Kerkelings vermeintlicher Authentizität zweifelte: „Mich würde interessieren, ob Hape privat genauso spielt oder ob er irgendwann wirklich echt ist.“
Das Publikum lachte, doch Kerkeling schwieg. Er verließ das Studio ohne ein Wort. Später erklärte er in einem Interview: „Es gibt Menschen, die verwechseln Klugheit mit Kälte“. Schmidt empfand dies wiederum als sentimentale Ausflucht. In einem seiner letzten Bühnenprogramme setzte er den spöttischen Schlusspunkt: „Kerkeling kann alles – singen, weinen, wandern – nur eines nicht: Ironie verstehen“. Die stille Antwort Kerkelings bei einer TV-Gala war elegant, aber spitz: „Ich mag Leute, die im Fernsehen über andere urteilen. Es zeigt, wie wenig sie über sich selbst wissen“. Was mit Bewunderung begann, mündete in einen kalten, stillen Wettstreit um Anerkennung, der Schmidts Abneigung gegen alles Sentimentale bestätigte.
Kapitel IV: Das Kräftemessen – Anke Engelke

Die Beziehung zwischen Harald Schmidt und Anke Engelke war von Anfang an ein Widerspruch. Sie galten als das „Traumpaar des deutschen Fernsehens“ – schlagfertig, intelligent und präzise. Doch hinter den Kulissen war ihre Zusammenarbeit, so Schmidt, ein „permanentes Kräftemessen“.
Der Streit begann mit einem Paukenschlag in einer Live-Sendung. Engelke improvisierte spontan einen Sketch, der Schmidts sorgfältig geplante Pointe „völlig überlagerte“. Das Publikum lachte deutlich mehr über sie als über ihn. Schmidt saß daraufhin minutenlang schweigend in der Maske, „starr vor Zorn“, unfähig, seinen Kontrollverlust zu verarbeiten.
Der Zusammenstoß eskalierte während einer Probe, als Engelke Schmidts Monolog unterbrach und forderte: „Lass mich, ich kann das freier machen“. Schmidt verließ daraufhin wütend den Raum. Der öffentliche Konflikt entflammte bei einer Preisverleihung, als Engelke mit einer Bemerkung über Schmidts „veralteten Humor“ die Aufmerksamkeit auf sich zog. Schmidt soll in der Loge daraufhin leise gesagt haben: „Wenn im Fernsehen nur noch Beifall zählt, habe ich hier nichts mehr verloren“.
Der endgültige Bruch kam in einem gemeinsamen Interview, in dem Engelke beiläufig bemerkte, Schmidt sei „zu kontrolliert, um wirklich lustig zu sein“. Schmidt reagierte mit kühler Präzision: „Manche Menschen machen sich über andere lustig, weil sie keine eigenen Pointen haben“. Für Schmidt war Engelke die Inkarnation der Eitelkeit und der unkontrollierten Improvisation, die seine sorgfältig zynische Konstruktion untergrub. Ihre beruflichen Wege gingen von diesem Augenblick an für immer auseinander.
Kapitel V: Der Anspruch des Usurpators – Jan Böhmermann
Wenn es einen gibt, der sich selbst als „legitimen Nachfolger“ von Harald Schmidt betrachtet, dann ist es Jan Böhmermann. Doch genau dieser Anspruch ist für Schmidt der Grund, ihn am meisten zu verachten. Schmidts tiefe Verachtung rührt daher, dass er Böhmermanns Satire für Lautstärke ohne Haltung hält.
Das erste Zusammentreffen auf einer Preisverleihung war sofort von Böhmermanns Respektlosigkeit geprägt, als er sich einen „Seitenhieb auf Schmidts veralteten Zynismus“ nicht verkneifen konnte. Schmidt reagierte nach außen hin regungslos, soll aber hinter der Bühne „außer sich vor Wut“ gewesen sein.
Bei einem erneuten Auftritt in einer Talkshow dominierte Böhmermann die Szene, indem er Schmidt ständig ins Wort fiel, seine Pointen mit einem „überlegenen, spöttischen Grinsen“ kommentierte und das Publikum mit provokanten Zwischenrufen zum Lachen brachte. Schmidt blieb still, unfähig, seinen messerscharfen Witz auszuspielen. Böhmermanns Behauptung, Schmidt habe „seinen Biss verloren“ und sei nur noch ein „Überbleibsel aus einer vergangenen Ära“, traf Schmidt zutiefst.
Schmidts schriftlicher Konter in einer Kolumne ist eine seiner klarsten philosophischen Aussagen zur Satire: „Er verwechselt Lautstärke mit Satire. Satire ist Haltung – und genau die fehlt ihm“. Für Schmidt ist Böhmermann ein Effekthascher, der sich hinter Provokation versteckt. Der Konflikt erreichte seinen Höhepunkt bei einer Gala. Als Böhmermann Schmidt ironisch als seinen Inspirator ankündigte, trat Schmidt ans Mikrofon und entgegnete eisig: „Von Inspiration wird man nicht satt. Ich ziehe Ergebnisse vor“.
Das Vermächtnis des Zorns: Die Frage, die bleibt
Harald Schmidts Liste der Verachtung ist nicht nur ein privates Dossier der Feindschaft, sondern ein politisch-kulturelles Manifest. Jeder der fünf Namen steht für eine Facette, die Schmidt als das Grundübel des modernen Mediensystems ablehnt: Raabs oberflächliche Kommerzialisierung, Lanz’ gespielte Tiefgründigkeit, Kerkelings emotionale Sentimentalität, Engelkes eitle Selbstinszenierung und Böhmermanns lärmende Effekthascherei.
In einer Welt, in der Unterhaltung oft auf Kosten von Inhalt geht, bleibt Harald Schmidts Abwesenheit vom Bildschirm sein lautstärkster Kommentar. Seine philosophische Haltung gegenüber Komik und Fernsehen beruht auf intellektueller Distanz und Sarkasmus, der sich weigert, dem Zeitgeist zu folgen. Er hat sich entschieden, zu schweigen, anstatt sich von den von ihm verachteten Figuren vereinnahmen oder übertönen zu lassen.
Die Abrechnung des 68-Jährigen ist die eines Meisters, der das Gefühl hat, die Kunstform, die er beherrschte, sei von jenen degradiert worden, die lediglich Lautstärke und Beifall suchen. Am Ende seiner Liste bleibt die einzige Frage, die ihm selbst noch von Bedeutung scheint – die Frage nach der Konsequenz: Wenn er diese fünf verachtete, „wer wohl verachtet ihn?“. Diese Frage ist Schmidts letzte, zynische Pointe, die über die Bildschirme hinaus in die Köpfe einer ganzen Nation hallt.