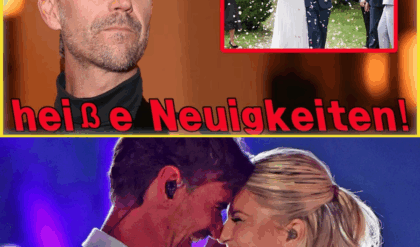Die stille Beichte des Albano: Nach 30 Jahren des Schweigens bricht die Musiklegende über das Trauma seiner verschwundenen Tochter Ylenia

Die stille Beichte des Albano: Nach 30 Jahren des Schweigens bricht die Musiklegende über das Trauma seiner verschwundenen Tochter Ylenia
Rom/New Orleans – Die Geschichte von Albano Carrisi, der italienischen Musiklegende, die die Welt mit dem unvergänglichen Hit Felicità verzauberte, ist eine solche, die das Leben selbst schrieb. Albano wurde im Jahr 1943 in Cellino San Marco, einer kleinen Gemeinde in der Provinz Brindisi im sonnenverbrannten Süden Italiens, geboren. Sein Leben begann weit entfernt von Scheinwerfern, Applaus und Ruhm.
Hinter dem sonnigen Klang, hinter den ausverkauften Konzerten und den lächelnden Duetten verbirgt sich ein Schmerz, der die Seele des Künstlers beinahe zerbrochen hätte: das mysteröse Verschwinden seiner ältesten Tochter Ylenia im Jahr 1994.
Fast drei Jahrzehnte lang herrschte Schweigen. Doch nun, im Alter von 82 Jahren, hat Albano in einem schockierenden, unerwarteten Interview mit dem italienischen Sender Rai Uno dieses Schweigen gebrochen und die schmerzliche Wahrheit enthüllt. Er sprach über die Nacht, die sein Leben für immer veränderte, über den Schmerz, der ihn zwang, die gerichtliche Todeserklärung zu beantragen, und über das tiefe Zerwürfnis mit seiner Partnerin Romina Power.
Es war eine Beichte von seltener Intensität, die das Publikum im Studio und Millionen vor den Bildschirmen zu Tränen rührte. „Ich habe jahrelang geschwiegen, um meine Familie zu schützen, aber Schweigen heilt nichts“, gestand Albano. „Es ist wie eine Mauer, hinter der die Geister noch lauter schreien“. Albano blickte in die Kamera, und in seinen Augen lag jener Ausdruck, den die Italiener „Il dolore sacro“ nennen: der Heilige Schmerz.
I. Der Aufstieg: Vom Landarbeiter zur „Felicità“
Albaus Eltern, Carmelo Carisi und Jolanda Otino, waren einfache Landarbeiter. Ihre Hände trugen die Härte des Bodens, und ihre Hoffnungen reichten selten über die Olivenheine hinaus. Doch inmitten dieses Kargenlebens keimte in dem jungen Albano ein unbändiger Wille, mehr zu werden und mehr zu leben. Schon früh zeigte sich in ihm ein ungewöhnliches Talent: eine Stimme, die kraftvoll und warm zugleich war.
Mit gerade einmal 17 Jahren verließ er sein Zuhause, ließ die staubigen Felder Apuliens hinter sich und machte sich auf nach Mailand, eine Stadt, die damals als Magnet für Träumer galt. Dort, in der Metropole des Nordens, begann Albano als Hilfsarbeiter, Kellner und Metallarbeiter. Doch die Musik ließ ihn nie los. Nach Feierabend sang er in kleinen Bars und auf privaten Festen. Jede Note, die er sang, trug eine Sehnsucht in sich, die schließlich gehört werden sollte.
Der Wendepunkt kam durch Zufall: Eines Abends fiel einem Gast in dem Restaurant, in dem er arbeitete, eine Demoband mit seiner Stimme in die Hände – der Gast war der bereits etablierte Star Adriano Celentano. Celentano gab Albano eine Chance.
Der endgültige Durchbruch kam 1967 mit dem Song Nel sole. Die Single katapultierte ihn an die Spitze der italienischen Charts. Nel sole wurde nicht nur ein Lied, sondern ein Symbol für den „einfachen Bauernsohn“, der von Aufstieg und Hoffnung träumte. Am Filmset der gleichnamigen Verfilmung traf er auf Romina Power, die Tochter der Hollywood-Legende Tyrone Power.
Die Duett-Ära: Die Geburt des Traumpaares
Albano und Romina, der „leidenschaftliche Sänger aus Apulien“ und die „kalifornische Künstlertochter“, schufen eine der größten künstlerischen Partnerschaften Italiens. Im Sommer 1970 gaben sie sich das Ja-Wort. Italien sah in ihnen das perfekte Paar, die Verbindung zwischen dem tief verwurzelten Süden und der modernen Welt.
Ihr goldenes Jahrzehnt begann in den frühen 1980er Jahren und gipfelte in Songs, die zu Hymnen einer ganzen Generation wurden: Sharazan, Ci sarà und vor allem Felicità. Das Lied, das schlicht „Glück“ bedeutet, wurde ihr Markenzeichen. In einer Zeit des Kalten Krieges und der Krisen erinnerten sie daran, dass Glück manchmal nur in einem gemeinsamen Lächeln lag. Hand in Hand lächelnd, strahlten sie eine Authentizität aus, die selbst die kühlsten Kritiker entwaffnete. Sie wurden das Symbol eines Italiens, das Optimismus, Familie und Gefühl vereinte.
Trotz aller Spannungen hielten sie zusammen, vor allem wegen ihrer vier Kinder. Doch je heller der Ruhm leuchtete, desto dunkler wurden die Schatten, die er warf.
II. Die Tragödie: Ylenias Verschwinden und der Zerfall der Liebe
Hinter der goldenen Fassade des Erfolgs lauerte eine Tragödie, die alles verändern sollte. Im Januar 1994 verschwand die älteste Tochter, Ylenia Carrisi, unter mysteriösen Umständen in New Orleans.
Die Flucht: Albano erzählte, dass Ylenia im Herbst 1993 innerlich auf der Suche war. Sie war fasziniert von der Freiheit, der Spiritualität und dem „Straßenleben“. Ihre Reise nach New Orleans sei, so glaubt Albano heute, eine „Art Flucht“ gewesen. In ihrem Tagebuch schrieb sie: „Ich möchte mich selbst finden, ohne dass mich jemand erkennt“.
Die letzte Nacht: Die letzte bekannte Sichtung fand an der Uferpromenade des Mississippi statt. Ein Wachmann berichtete, sie habe gesagt: „Ich gehöre dem Wasser“. Seitdem blieb sie verschwunden – keine Leiche, kein Abschiedsbrief, nur Fragen, Schweigen und ein Schmerz, der die Familie für immer veränderte.
Das Verschwinden spaltete Albano und Romina:
Romina klammerte sich an die Hoffnung, ihre Tochter lebe noch, vielleicht freiwillig verschwunden. Sie suchte Zuflucht in spirituellen Kreisen.
Albano hingegen, der pragmatischere, musste sich dem Unaussprechlichen stellen: Er glaubte Ylenia sei tot. „Ich habe nicht nur eine Tochter verloren“, sagte er, „sondern auch den Glauben daran, dass das Leben je wieder so sein kann wie früher“.
Die Liebe zerbrach an dieser unüberbrückbaren Differenz. Ihre Duette, die einst Liebe und Harmonie versprachen, wurden nun zum Spiegel von Nähe und Distanz, von Liebe und Zweifel. Im Jahr 1999 gaben sie offiziell ihre Trennung bekannt.
Der Akt der Liebe: Die Todeserklärung
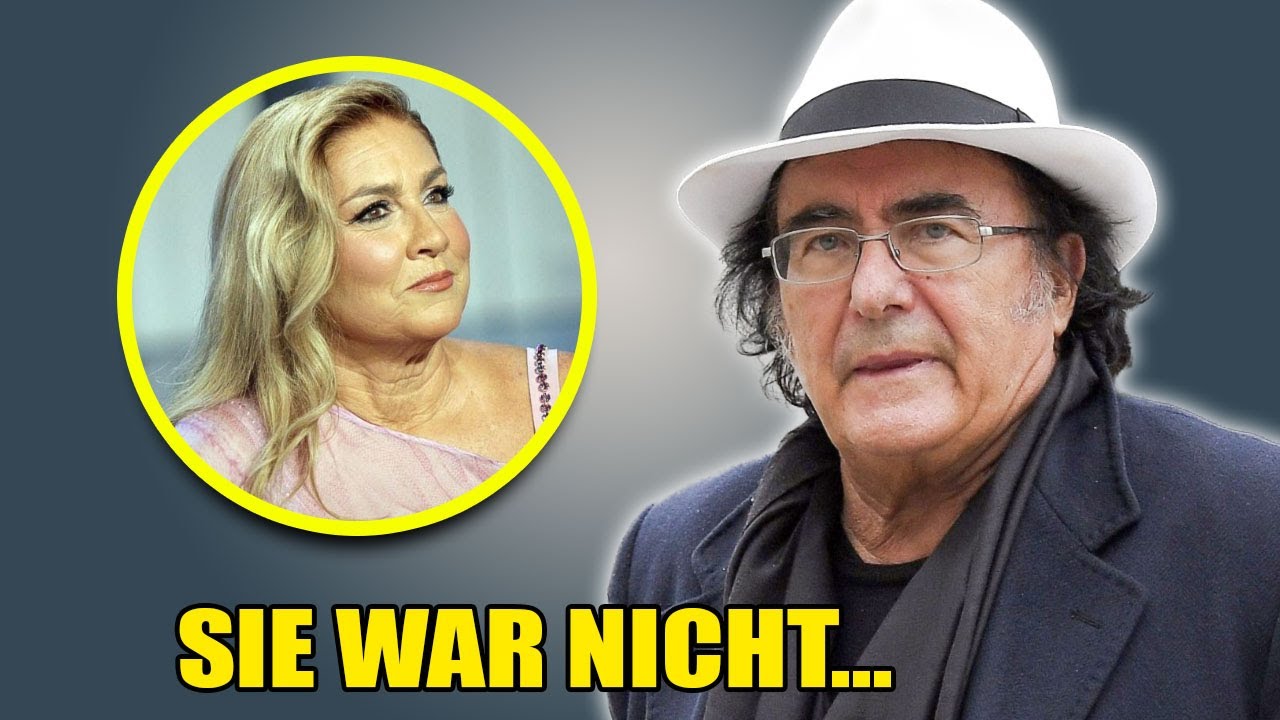
Der schmerzhafteste Teil seiner Beichte war die Erklärung für die gerichtliche Todeserklärung Ylenias im Jahr 2014. Romina Power reagierte damals mit Wut und Entsetzen und warf ihm vor, die Hoffnung getötet zu haben. Sie sprachen monatelang nicht miteinander.
Albano verteidigte seine Haltung nun ohne Bitterkeit. Für ihn war die Todeserklärung „kein Akt des Aufgebens, sondern ein Akt der Liebe“. Er wollte, „dass ihre Seele Ruhe findet“. Solange die Welt sie als verschollen bezeichnete, blieb sie gefangen „irgendwo zwischen Leben und Tod“.
Albano enthüllte zudem, dass er im vergangenen Jahr fast heimlich nach New Orleans zurückgekehrt sei, um an jener Stelle am Mississippi zu stehen, wo seine Tochter zuletzt gesehen wurde. Dort habe er ihr gesagt: „Wenn du irgendwo bist, hör auf zu kämpfen, ich trage dich weiter“.
III. Die Heilung: Musik als Gebet und die neue Stiftung
Nach Jahren der Einsamkeit und einer turbulenten Beziehung mit der Fernsehmoderatorin Loredana Lecciso, fand Albano Trost und eine Art spiritueller Reife in seiner Musik. „Musik ist das einzige, das mein Herz heilen kann“, gestand er. Seine Lieder handeln heute nicht mehr nur von Liebe, sondern von Verlust, Glauben und der Suche nach innerem Frieden. Wenn er auf die Bühne tritt, steht dort kein Star, sondern „ein Mensch, der gelernt hat, den Schmerz in Melodien zu verwandeln“.
Als Zeichen seiner Heilung und seines Vermächtnisses offenbarte Albano, dass er eine kleine Stiftung gegründet hat, benannt nach Ylenia, um Straßenkindern in Süditalien Bildung und Unterkunft zu bieten. „Ich kann sie nicht zurückbringen“, sagte er, „aber ich kann verhindern, dass andere verschwinden“. Diese Worte lösten im Studio minutenlangen, ehrlichen Applaus aus.
Albano ist heute ein Symbol dafür, dass selbst im tiefsten Verlust ein Funke Hoffnung weiterglimmt. Er hat die Sprache des Schmerzes in eine Sprache der Liebe verwandelt. Die Botschaft, die er in seinen Konzerten hinterlässt, ist die einer tiefen Dankbarkeit an das Leben: „Wahre Stärke ist nicht, keine Tränen zu weinen, sondern trotz der Tränen weiterzusingen“. Seine späte Beichte ist der Beweis dafür, dass der Schmerz uns formt, aber uns nicht definieren muss, wenn wir den Mut finden, die Wahrheit auszusprechen.