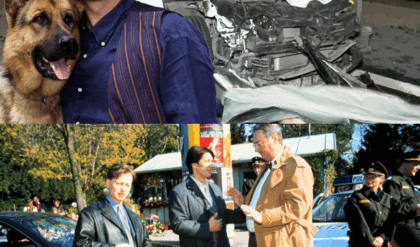„GENUG VON DIESEM WAHNSINN!“: Orbáns Eklat in Brüssel – Wie er den EU-Gipfel sprengte, von der Leyen demütigte und eine unerwartete Revolte anzettelte

Es war ein Moment, der die sterile, marmorne Routine Brüssels in einem einzigen Augenblick zerspringen ließ. Ein Schockmoment, der wie ein Donnerschlag durch die Säle der Macht hallte. Ein halbe Stunde zuvor war die Stimmung noch gelöst. Lächelnde Gesichter, Händeschütteln, belangloser Smalltalk. Auf der Bühne spielte Ursula von der Leyen, die „Kaiserin von Brüssel“, ihr bekanntes Theater – großspurige Worte, Pathos, die Attitüde einer Generalin in Designerschuhen. Neben ihr ein gelangweilter Emmanuel Macron und ein stumm blickender Friedrich Merz. Sie alle warteten nur darauf, dass der Vorhang fällt.
Viktor Orbán, der ungarische Premier, fehlte. Er hatte sich verspäten lassen. Die EU-Bürokraten, so wird berichtet, grinsten erleichtert. Endlich kein Störenfried, kein ungarischer Blockierer. Nur Robert Fico aus der Slowakei saß isoliert in einer Ecke und blickte immer wieder auf Orbáns leeren Stuhl – das Symbol der fehlenden Opposition gegen Brüssels Kriegspläne.
Die Tagesordnung des Rates vom 23. Oktober las sich harmlos. Mehr Hilfe für die Ukraine. Dieselben abgenutzten Versprechen. Doch jeder im Saal wusste, was es bedeutete: Milliarden für Kiew, eine Fesselung Europas an die ukrainische Wirtschaft auf Jahrzehnte, ohne einen Plan, woher das Geld kommen oder wie es je zurückgezahlt werden sollte. Es war eine brutale Botschaft an die europäischen Steuerzahler: Eure Stimme zählt nicht.
Obendrauf lag der Plan „Readiness 2030“ – der Bauplan für eine europäische Armee. Und als Krönung das 19. Sanktionspaket, das erstmals den russischen Gassektor treffen und eingefrorene russische Milliarden per Beschluss nach Kiew umleiten sollte. Ursula von der Leyen strahlte, ihr Post auf X klang wie eine Kriegserklärung: „Europa wird den Druck erhöhen… solange es nötig ist.“
Dann passierte das Unfassbare.
Plötzlich stand er hinten im Saal: Viktor Orbán, Europas „schwarzes Schaf“, direkt eingeflogen vom Friedensmarsch in Budapest, wo Zehntausende demonstriert hatten. Sein Blick wanderte über Selenskyj, von der Leyen und Merz. Dann sprach er den Satz, der wie ein Sprengsatz wirkte: „Genug von diesem Wahnsinn!“
Stille. Totenstille. Der Mann, den Brüssel am liebsten ignorieren würde, war gekommen, um den Tag zu sprengen. Was folgte, war kein diplomatisches Geplänkel, es war eine Anklage. Orbán warf den EU-Eliten vor, Europa vom bloßen Sponsor zum „direkten Kriegsakteur“ zu machen. Er machte keinen Hehl aus seiner Überzeugung: „Ihr habt euch selbst so tief in diesen Konflikt hineingezogen. Ihr habt die Ukraine überhaupt erst dazu ermutigt. Ihr habt sogar die Friedensversuche des amerikanischen Präsidenten blockiert!“
Die Masken fielen. Orbán entlarvte die Lüge vom alternativlosen Kriegskurs. Wenige Tage zuvor hatte er in Budapest auf dem Platz der Helden gesprochen, dort, wo die ungarischen Fahnen schwangen. Dort wurde aus kühler Analyse leidenschaftlicher Patriotismus. „Ja zur Europäischen Union, nein zu Brüssel!“, rief er. Und dann der Satz, der das Verhältnis auf den Punkt brachte: „Mit denen gibt es keinen Mittelweg. Wer mit Brüssel verhandelt, kapituliert!“ Der Platz explodierte.
Jetzt stand derselbe Mann in Brüssel. Die EU-Spitzen hatten ihn als „Marionette Moskaus“ verhöhnt. Doch Orbán lächelte nur spöttisch. Er war nicht gekommen, um wegzulaufen. Er war gekommen, um zu kämpfen. „Ich werde fest zur ungarischen Position stehen“, donnerte er. „Dieser Gipfel beweist nur eines: Die kommenden Monate werden von eurer Rücksichtslosigkeit geprägt sein.“ Es war in diesem Moment, so berichten Beobachter, dass die Mächtigen in Brüssel begriffen: Das schwarze Schaf war zum Wolf geworden.
Doch die Eskalation hatte erst begonnen. Es ging um die zweite Front: das Geld. Brüssel präsentierte seinen Plan, die eingefrorenen russischen Vermögenswerte – Hunderte Milliarden Euro – zu „öffnen“. Die Erträge, geschätzte 140 Milliarden, sollten direkt an die Ukraine fließen. Verkauft wurde es als „clevere Buchhaltung“, abgesichert durch einen Sonderfonds, konstruiert, um das Einstimmigkeitsprinzip zu umgehen. Orbán nannte es beim Namen: „Diebstahl im Namen der Solidarität.“
Sein Außenminister, Péter Szijjártó, legte mit brennender Wut nach: „Anstatt sich Europas wirklichen Herausforderungen zu stellen – der Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit, der Sicherung der Energieversorgung –, konzentriert sich Brüssel einzig darauf, die ukrainische Armee und den ukrainischen Staat zu finanzieren!“
In Brüssel zuckte man nur mit den Schultern. Hinter verschlossenen Türen, so heißt es, tuschelten Beamte bereits über juristische Tricks und Schlupflöcher, um Ungarns Veto zu umgehen. Demokratie – eine Formalie.
Doch genau in dem Moment, als Brüssel glaubte, Orbán endgültig isoliert zu haben, geschah das Unvorhergesehene. Ein neuer Akteur betrat die Bühne, einer, den niemand auf der Rechnung hatte: Belgien.
Bart De Wever, Premierminister eines der loyalsten EU-Partner, trat aus der Kulisse und sprach mit brutaler Ehrlichkeit. „Dieser 140-Milliarden-Euro-Plan ist vollkommen wahnsinnig!“, donnerte er. Die Worte trafen wie ein Faustschlag. Während Merz und Macron schwiegen, schlug De Wever mit der Faust auf den Tisch. Sein Blick bohrte sich in Ursula von der Leyen: „Wer garantiert, dass Belgien am Ende nicht für Europas Spielschulden aufkommt? Wer übernimmt die Verantwortung, wenn alles zusammenbricht? Ihr? Oder die Menschen in meinem Land?“
Es war die erste offene Revolte eines westeuropäischen Staates. De Wever nannte die Beschlagnahmung russischer Vermögen ein „finanzielles Minenfeld“, ein Spiel, das das Vertrauen in das gesamte europäische Bankensystem untergraben würde. Denn wer, so die unausgesprochene Frage, vertraut noch europäischen Banken, wenn Vermögen nach politischem Willen einfach beschlagnahmt werden können?

Die Antwort war Schweigen. Weder von der Leyen noch Macron noch Merz konnten die geforderte Garantie geben.
Belgien nutzte seinen Einfluss und blockierte die gesamte Operation. Die Abschlusserklärung, gedacht als Triumphzug, wurde zur Unkenntlichkeit verwässert. Statt klarer Beschlüsse gab es nur vage Formulierungen. Ursula von der Leyen tobte. Ihre Pläne lagen in Trümmern.
Der Gipfel endete mit einem bizarren Bild: Belgien, das Herz der EU, stellte sich an die Seite des “Paria” Ungarn. Ein kleines Land hatte es gewagt, der mächtigsten Bürokratie Europas die Stirn zu bieten. Orbán hatte eine zweite Front eröffnet: Zweifel im Westen.
In den Hinterzimmern, als die Kameras längst aus waren, begann das eigentliche Spiel. Kommissionsbeamte flüsterten über „Optionen“ und „Schlupflöcher“. Man dürfe sich „nicht erpressen lassen“. Ein Trick kursierte: Man könne die Gelder über einen Fonds in Luxemburg waschen, abgesichert durch Anleihen, um Ungarns Veto zu umgehen. Kreative Buchhaltung. Methoden, die eher an mafiöse Geldwäsche erinnerten als an demokratische Beschlüsse.
Doch draußen, im echten Europa, wuchs der Mythos Orbán. Sein Satz „Genug von diesem Wahnsinn“ wurde zum Slogan auf Bannern und in Hashtags. Selbst in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden fand er plötzlich Anhänger – Menschen, die genug hatten von Inflation, explodierenden Energiepreisen und einem Dauerkrieg ohne Ende.
Gleichzeitig wuchs der Druck von unten. In Berlin, Paris und Wien gingen Tausende auf die Straße. Nicht nur AfD-Anhänger, sondern Familien, Gewerkschafter, Rentner. Ihre Botschaft: Frieden statt Waffen. Die deutsche Wirtschaft rutschte in die Rezession, während die Regierung Milliarden nach Kiew pumpte. Friedrich Merz, der beim Gipfel devot neben Ursula von der Leyen stand, geriet in der eigenen Partei unter Druck. Junge Unionspolitiker warfen ihm vor, den Kontakt zur Basis verloren zu haben.
Orbán hatte den Funken entzündet, der nun einen Flächenbrand auszulösen drohte. Er hatte 1956 als Jahr des Freiheitskampfes gegen sowjetische Panzer beschworen. Heute, so seine Botschaft, sei Budapest die Hauptstadt des Friedens, die gegen Brüssels Bürokraten und Kriegsfanatiker kämpft.
Mit diesen Worten beendete er seine explosive Rede auf dem Gipfel, drehte sich um und stapfte wütend hinaus. Er ließ sechs Staats- und Regierungschefs wie versteinert zurück. Sein Stuhl blieb am Ende leer, doch sein „Nein“, sein spöttisches Lächeln und die unerwartete Revolte Belgiens hallten lauter als jede Rede, die an diesem Tag in Brüssel gehalten wurde. Die eiserne Maschinerie war nicht unzerstörbar. Sie hatte einen Riss bekommen.