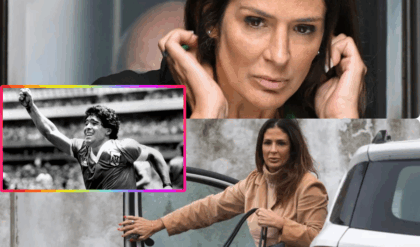Hinter dem Rosenheim-Lächeln: Igor Jeftić bricht sein Schweigen über den tiefen Schmerz, seinen Zusammenbruch am Set und die radikale Wende mit 54 Jahren

Hinter dem Rosenheim-Lächeln: Igor Jeftić bricht sein Schweigen über den tiefen Schmerz, seinen Zusammenbruch am Set und die radikale Wende mit 54 Jahren
Millionen kennen ihn als Kommissar Jens Stolten in der überaus beliebten ZDF-Serie Die Rosenheim-Cops. Er ist das charismatische Gesicht des deutschen Fernsehens, bekannt für sein charmantes Lächeln, die klugen Augen und eine ruhige, überlegte Art. Doch hinter der Fassade des erfolgreichen TV-Ermittlers verbirgt sich eine Geschichte, die weit tiefer, ehrlicher und schmerzhafter ist, als jede Rolle, die Igor Jeftić je gespielt hat.
Mit 54 Jahren hat der in Belgrad geborene Schauspieler mit serbischer Herkunft und deutschem Alltag eine Entscheidung getroffen, die seinen Charakter und seine Karriere neu definiert: Er bricht sein langes Schweigen und gesteht, was viele lange nur vermuteten – ein Leben, das von innerer Zerrissenheit, einem tiefen Verlust und einem dramatischen körperlichen Zusammenbruch geprägt war. Dieses Geständnis öffnet die Tür zu einem Menschen, der gelernt hat, dass wahre Stärke nicht bedeutet, keine Angst zu haben, sondern sie auszuhalten und am Ende die eigene Wahrheit zu leben.
Der Mann zwischen den Welten: Stärke als Mauer
Igor Jeftić ist kein Mann der schnellen, oberflächlichen Antworten. Er ist ein Beobachter, ein Denker, der jedes Wort wägt, bevor er es ausspricht. Diese Zurückhaltung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines Lebens, das früh von existenziellen Fragen geprägt wurde. Aufgewachsen als Sohn serbischer Eltern in Deutschland, musste er sich schon als Kind zwischen zwei Kulturen, Sprachen und Identitäten bewegen. „Ich wusste nie genau, wohin ich gehöre“, sagte er einmal. Diese innere Zerrissenheit, das Gefühl, immer „ein bisschen anders“ zu sein, prägte ihn tief. Paradoxerweise wurde genau diese Heimatlosigkeit zu seinem schauspielerischen Talent: „Vielleicht hat mich genau das zu einem Schauspieler gemacht. Ich konnte mich in viele hineinversetzen.“
Er lernte früh, eine Mauer um sich zu errichten. Das Ideal der Stärke, das ihm seine Umwelt vermittelte, war jedoch keine Lösung, sondern eine Last. Er war stets derjenige, der funktionieren, der die Erwartungen erfüllen musste. Dieses Versteckspiel der Emotionen hielt er lange Zeit aufrecht, bis es ihm fast das Herz kostete.
Der Abgrund der Trauer: Als die Welt still wurde
Der größte Schmerz im Leben eines Menschen kommt oft nicht von außen, sondern von dem, was man verliert, obwohl man alles getan hat, um es zu behalten. Für Igor Jeftić war dieser Wendepunkt der Tod seiner Mutter. Sie war nicht nur eine Verwandte, sondern sein Anker, seine Vertraute, die erste, die bedingungslos an seine Träume glaubte und ihn ermutigte, Schauspieler zu werden, als andere noch lachten.
Als sie ging, brach für Igor Jeftić eine Welt zusammen. „Als sie ging, hatte ich das Gefühl, dass die Welt still wurde“, erinnert er sich. „Ich habe in dieser Stille fast den Verstand verloren.“ Die Trauer fraß sich tief in ihn hinein. Der stolze, schweigsame Vater sah den Sohn zum ersten Mal in seinem Leben weinen, ein Moment tiefster Hilflosigkeit für beide Männer.
Jeftić versuchte, den Schmerz zu verdrängen. Er arbeitete weiter, lächelte für die Kameras und sagte seine Texte. Doch innerlich war er leer. Die Trauer fiel in eine Zeit privater Wirren; eine Beziehung war zerbrochen. Entwurzelt, heimatlos im eigenen Leben, beschreiben ihn Freunde als nachdenklich, verschlossen, fast scheu. Er zog sich aus der Gesellschaft zurück. „Ich stand am Set, ich lächelte, ich sagte meine Texte, aber ich fühlte nichts. Es war, als wäre mein Herz aus Stein.“
Erst Jahre später fand er die heilsame Erkenntnis, die ihn befreite: „Ich musste verstehen, dass Trauer kein Feind ist“, sagte er. „Sie ist Liebe, die keinen Platz mehr findet.“ Diese tiefe Einsicht ermöglichte es ihm, den Schmerz anzunehmen und ihn in seine Kunst zu transformieren. Er begann, Rollen zu wählen, die Verletzlichkeit zuließen, und das Publikum spürte in jedem Blick, in jedem Satz, das Echo seiner eigenen, erlittenen Geschichte.
Der Schrei des Körpers: Notbremse am Set
Die innere Leere, die jahrelange Verdrängung und der unerbittliche Druck, immer stark sein zu müssen, forderten schließlich einen hohen Preis. Der eigentliche, lebensverändernde Wendepunkt kam während eines Drehs. Ein langer Tag, viel Stress, zu wenig Schlaf. Getrieben von hohen Erwartungen und der Verantwortung für ein ganzes Team, machte er weiter, bis er plötzlich in sich zusammenbrach.
Es war kein dramatischer Sturz, sondern ein leiser Moment, in dem sein Körper die Notbremse zog. „Ich stand einfach da und plötzlich wurde alles schwarz“, erzählte er später.
Im Krankenhaus folgte die erschütternde Diagnose: Herzrhythmusstörungen, extreme Erschöpfung, beginnende Depression. Die Ärzte waren unmissverständlich. Sie sagten ihm: „Ich müsse mein Leben ändern, sonst würde es mein Leben ändern – und zwar endgültig.“
Dieser Schock zwang Igor Jeftić, sich selbst zum ersten Mal wirklich als Mensch zu sehen, nicht als Schauspieler oder öffentliche Figur. Er erkannte, dass er jahrelang gegen sich selbst gearbeitet hatte, getrieben von einem falschen Ideal. „Ich war immer der, der stark sein musste“, reflektierte er.
Die Stille der Heilung und das zweite Leben
Die Zeit der Genesung wurde zur Zeit der Stille. Er zog sich komplett zurück: keine Drehs, keine Interviews, keine Bühne. Nur in dieser selbstgewählten Isolation konnte er das finden, was er lange verloren hatte: sich selbst. „Ich habe zum ersten Mal wieder geatmet“, sagte er, „und ich habe gemerkt, ich lebe noch.“
Die Beziehung zu seinem Vater, lange von Schweigen geprägt, vertiefte sich in dieser Krise. Sie sprachen zum ersten Mal über alles, über Angst, Verlust und Liebe. Der Satz seines Vaters: „Er hat mir gesagt, dass er stolz auf mich ist, und das war vielleicht der schönste Satz meines Lebens“, markierte eine tiefgreifende Versöhnung.
Als Igor Jeftić in die Öffentlichkeit zurückkehrte, war er ein anderer Mensch – ruhiger, wacher, echter. Er begann, offen über psychische Gesundheit, Druck und die Notwendigkeit zu sprechen, als Mann Schwäche zeigen zu dürfen. „Ich will keine perfekte Karriere“, ist heute sein Credo, „ich will ein ehrliches Leben.“ Er ist heute davon überzeugt: „Ich habe damals alles verloren, was mich definierte, und genau dadurch habe ich mich selbst gefunden.“
Liebe jenseits der Bühne: Die stille Kraft der Partnerin

Auch das Kapitel Liebe war für ihn lange ein Spiegelbild seiner inneren Unsicherheit. Durch seine Rastlosigkeit, seinen Beruf und seine Angst vor Kontrollverlust war es ihm lange schwergefallen, eine dauerhafte Bindung aufzubauen. „Ich konnte Liebe nur fühlen, wenn ich mich sicher fühlte“, erklärte er, „und Sicherheit war für mich lange ein Fremdwort.“
Doch dann trat eine Frau in sein Leben, die alles änderte. Sie war keine Kollegin, keine Schauspielerin, sondern jemand, der außerhalb seiner Welt lebte – bodenständig, ehrlich, frei von Eitelkeit. „Sie hat mich angesehen, als wäre ich ein Mensch, kein Schauspieler“, beschreibt er den Moment der Erkenntnis. Mit ihr erlebte er Frieden. Er konnte mit ihr schweigen, ohne sich fremd zu fühlen.
Ihre Liebe musste jedoch eine harte Probe bestehen. Der Beruf, die ständige Abwesenheit, die Müdigkeit – es gab Zeiten, in denen sie an Trennung dachten, nicht aus Mangel an Zuneigung, sondern aus schierer Erschöpfung. Doch eine gemeinsame familiäre Krankheit lehrte sie Demut und führte sie wieder zusammen. Sie lernten, dass Liebe nicht die Flucht ist, sondern das Bleiben.
Heute sind sie nicht verheiratet, aber tief verbunden. Er nennt sie seine Lebensgefährtin und Vertraute. „Ich brauche kein Papier“, sagt er, „ich brauche nur jemanden, der mich versteht, wenn ich schweige.“ Sie ist diejenige, die seine Zweifel erkennt, die ihn spürt, wenn er still wird. „Das Schönste, was sie mir beigebracht hat, ist, dass Schweigen manchmal mehr sagt als tausend Worte.“
Das Vermächtnis des Menschseins: Reichtum der Einfachheit
Mit Mitte 50 steht Igor Jeftić an einem Punkt, an dem er bewusst lebt. Er hat die Lektion der Verantwortung gelernt, die ihm sein Körper erteilt hat. Er treibt regelmäßig Yoga, meditiert und ernährt sich bewusst. Gesundheit, so seine Überzeugung, ist kein Besitz, sondern eine Verantwortung.
Er spricht heute offen über mentale Gesundheit und die Schwierigkeit, als Mann Schwäche zu zeigen. „In unserer Kultur bedeutet Männlichkeit oft Härte“, sagt er, „aber ich finde, Mut hat mehr mit Sanftheit zu tun.“
Sein geschätztes Vermögen liegt zwar bei rund 2 Millionen Euro, doch er lebt bewusst und einfach – nicht luxuriös. Er wohnt in einer schlichten Altbauwohnung in München, sammelt keine teuren Trophäen, sondern Geschichten von seinen Reisen in kleine Dörfer. Sein größter Luxus ist die Freiheit, zu Projekten und Menschen Nein sagen zu können, die ihm Energie nehmen. „Ich arbeite nicht mehr für Ruhm“, sagt er. „Ich arbeite, weil ich etwas sagen will.“
Er spendet regelmäßig an Organisationen, die Kindern in Krisengebieten helfen, sowie an Stiftungen für psychische Gesundheit. Sein Reichtum misst sich nicht in Geld, sondern in Zufriedenheit und Dankbarkeit. Er braucht nicht viel, um erfüllt zu sein – ein gutes Gespräch, klare Luft, eine Hand, die seine hält. Sein Vermächtnis ist die Kunst, Mensch zu bleiben, trotz Ruhm und trotz Schmerz. „Wenn man sich selbst treu bleibt“, schließt Igor Jeftić, „dann überlebt man alles.“