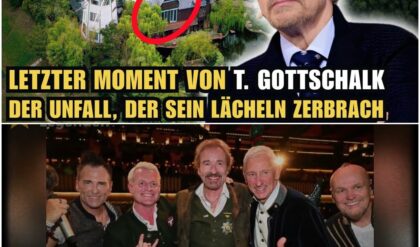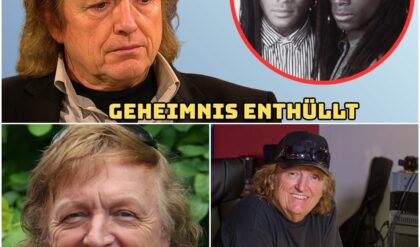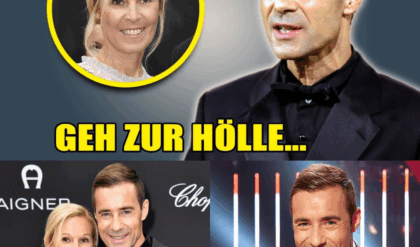Scharia oder Heimat: Das schockierende Bekenntnis einer Konvertitin, die den Nikab als “Freiheit” verteidigt und ihre Loyalität über das Schweizer Gesetz stellt.

Freiheit im Nikab: Der erschütternde Loyalitätskonflikt einer Konvertitin und die Entlarvung des Salafismus in der Debatte um den Schleier
Die Diskussion um die Vollverschleierung ist in westlichen Gesellschaften ein tief emotionales und politisch aufgeladenes Thema, das die Grenzen zwischen religiöser Freiheit, kulturellem Zwang und nationaler Identität auslotet. In einer aufsehenerregenden TV-Diskussion stellte sich die 28-jährige gebürtige Schweizerin Nora Illi, die vor zehn Jahren zum Islam konvertierte, den kritischen Fragen einer deutschen Autorin. Illi, die den Gesichtsschleier (Nikab) trägt, verteidigte ihre Entscheidung vehement als Akt der Freiheit und des persönlichen Schutzes. Doch die Konfrontation entlarvte schnell die tiefer liegenden Konflikte um Salafismus, Zwang und die ultimative Loyalität zum Staat.
Die Wahl der Freiheit: Schutz vor Blicken und Mimik
Nora Illi, Tochter aus bürgerlichem Elternhaus, die eine Vergangenheit in der Punkbewegung hatte, repräsentiert eine untypische Konvertiten-Biografie. Sie begründete ihre Entscheidung für den Nikab nicht als Pflicht, sondern als „normative Option“ und „besseren, einfacheren Weg“ zur Ausübung ihres Glaubens.
Die Begründung der Schweizerin, die den Schleier nicht als religiöse Pflicht, sondern als persönlichen Schutz wählte, überraschte: Der Nikab biete ihr Schutz davor, mit ihrer „Mimik gewisse Gefühle Signale aussende[n], die ich nicht aussenden möchte“. Es sei auch ein „Schutz davor betrachtet zu werden, dass sich jemand ja sozusagen an mir ergötzt“. Sie führte aus, dass es in der Schweiz üblich sei, Fremde anzulächeln und eine starke Mimik zu zeigen. Der Nikab helfe ihr, eine „mehr Distanz wahren“ zu können und ermögliche es, dass man erst „mit mir eher ins Gespräch kommen muss, bevor man wirklich über mich urteilen kann“.
Auf die banalen, aber essenziellen Fragen ihrer Gesprächspartnerin – ob das Gesichtsfeld oder das Atmen eingeschränkt sei – antwortete Illi ruhig und verneinend. Sie könne sich frei bewegen, und der Stoff liege nicht direkt auf Mund und Nase auf, was die Alltagstauglichkeit des Schleiers unterstreiche.
Die Autorin entgegnete jedoch scharf, dass Illis Gefühl der „Freiheit in dem Schleier“ wie „Hohn“ klinge, wenn Millionen Frauen weltweit genau dafür bestraft werden, dass sie ihn nicht tragen.
Das Salafismus-Dilemma: Religion oder Ideologie?

Die Diskussion verschärfte sich, als die Autorin die religiöse und ideologische Einordnung des Nikabs thematisierte. Sie konfrontierte Illi mit der Beobachtung: „diese Art von Schleier [gibt’s] doch nur zu im Zusammenhang mit Salafismus.“
Die Autorin stellte klar, dass der Schleier in den meisten Religionen nicht existiere und seine strenge Form nur in Verbindung mit einer besonders konservativen, fundamentalistischen Auslegung des Islam auftauche. Damit stellte sie Illi vor die heikle Frage: Steht ihre verschleierte Lebensweise im Einklang mit der Scharia, und stellt sie diese über das weltliche Gesetz der Schweiz?
Illi verteidigte sich, indem sie eine klare Unterscheidung zwischen Religion und Kultur forderte. Sie räumte ein, dass der Zwang zur Vollverschleierung, wie er in manchen Kulturen herrsche, „nicht als sinnvoll“ sei, da es eine „Sache zwischen der Frau und Allah“ sei. Sie beharrte darauf, dass der Zwang „rein kulturell“ sei, nicht religiös.
Doch diese Unterscheidung wurde von der Autorin in einem zentralen Punkt konterkariert, der die Loyalitätsfrage zuspitzte: Die Frage nach der ultimativen Autorität.
Loyalitätskonflikt: Scharia über das Gesetz des Landes
Die deutsche Autorin führte die Debatte auf den härtesten und entscheidendsten Punkt zu: die Loyalität gegenüber dem Heimatland versus der religiösen Überzeugung. Sie verwies auf das Beispiel Frankreichs, wo die Burka im öffentlichen Leben verboten ist und Verstöße mit hohen Geldstrafen geahndet werden – bis zu 30.000 Euro für Männer, die ihre Frauen dazu zwingen.
Die rhetorische Falle für Nora Illi war damit gestellt: „Angenommen die Schweiz […], würde das machen, was würden Sie dann tun? Würden Sie sich dann entscheiden für ihr Heimatland Schweiz oder für ihre Religion?“
Nach kurzem Zögern und der Betonung der Unterscheidung zwischen Kultur und Religion traf Nora Illi ihr schockierendes Bekenntnis:
„Ja, ganz klar eben meine Religion. Der Islam ist mein Leben und für mich würde das dann immer heißen […] sie würde lieber in ihrem Haus bleiben, als auf ihren Schleier zu verzichten.“
Die Konsequenz eines Verbotes in der Schweiz wäre für Illi die faktische soziale Isolation: Sie müsste sich „nur noch im privaten Räumlichkeiten, Auto, zu Hause, bei Freundinnen etc. bewegen“. Dieses Bekenntnis, die persönliche „seelische Heimat“ über die weltliche Heimat zu stellen, war ein offenes Eingeständnis, dass im Falle eines Konflikts die Scharia oder die persönliche Auslegung des Glaubens Vorrang vor dem Schweizer Gesetz hätte. Die Autorin fasste die Brisanz des Moments schonungslos zusammen: „Loyalität klar nicht beim eigenen Land.“

Fazit: Die zerrissene Gesellschaft
Das Interview mit Nora Illi ist ein Brennglas für die Spannungen einer multikulturellen Gesellschaft. Es beleuchtet die Komplexität der Vollverschleierung, die nicht nur eine Frage der Kleidung ist, sondern tief in Fragen von Autonomie, Geschlechterrollen und der Kompatibilität von fundamentalistischen Glaubensauslegungen mit dem westlichen Rechtsstaat wurzelt.
Die Verteidigung des Nikabs als „persönliche Entscheidung zwischen mir und Gott“ wird durch die Tatsache konterkariert, dass diese Form der Verschleierung in der Praxis fast ausschließlich im Kontext des Salafismus auftritt – einer Ideologie, die von Verfassungsschutzbehörden als Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung eingestuft wird.
Nora Illis radikale Loyalität zum Schleier, die sie bereit macht, sich aus der Gesellschaft auszuschließen, anstatt ihn abzulegen, wirft die dringende Frage auf, wie ein liberaler Staat mit Überzeugungen umgehen soll, die die eigenen Gesetze de facto ablehnen. Die Debatte macht schmerzhaft klar: Während der Staat die Religionsfreiheit schützt, muss er gleichzeitig verhindern, dass diese Freiheit zur Grundlage für eine innere Abspaltung vom nationalen Rechts- und Gesellschaftsrahmen wird. Die Antwort der Konvertitin zur Wahl zwischen Schleier und Heimat ist ein unbequemes Alarmsignal für die Integration und die Koexistenz verschiedener Loyalitäten in westlichen Demokratien.