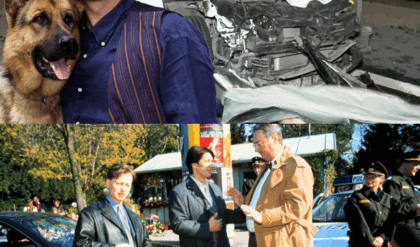Steinmeiers fatale „Weihnachtsrede“: Warum sein sofortiger Rücktritt das wirksamste Mittel gegen den Aufstieg der AfD wäre
Steinmeiers fatale „Weihnachtsrede“: Warum sein sofortiger Rücktritt das wirksamste Mittel gegen den Aufstieg der AfD wäre
Selten hat eine Rede aus dem höchsten Amt der Bundesrepublik Deutschland eine derart explosive Mischung aus Lob und vernichtender Kritik ausgelöst. Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kürzlich mit überraschender Deutlichkeit und historischer Schärfe vor Verfassungsfeinden und extrem rechten Gruppen warnte, schien er die Rolle des überparteilichen Hüters der Demokratie mit neuem Leben zu füllen. Doch die vermeintliche Verteidigung der freiheitlichen Grundordnung entpuppte sich für viele Beobachter – und das ist das politische Paradoxon – als ein „Weihnachtsgeschenk“ der Sonderklasse für die Alternative für Deutschland (AfD). Die Diskussion ist längst keine juristische mehr; sie ist hoch emotional, polarisierend und gipfelt in einer Forderung, die in der deutschen Politik einem Erdbeben gleichkommt: Der Rücktritt des Bundespräsidenten könnte die logischste und wirksamste Konsequenz aus seinem politischen Fehlversagen sein.
Die „Historische Deutlichkeit“ – Ein Präsident in der Pflicht?
Frank-Walter Steinmeier hatte sich in den vergangenen Jahren oft Zurückhaltung auferlegt. Das Amt des Bundespräsidenten ist vor allem ein moralisches, eines der Mahnung und der Integration, das traditionell über dem tagespolitischen Kleinkrieg schwebt. Genau deshalb wirkte sein jüngster, glasklarer Aufruf gegen Extremismus, der unmissverständlich den rechten Rand des politischen Spektrums ins Visier nahm, wie ein Paukenschlag.
Er sprach von „Gruppen vom rechten Rand“, die „unsere Verfassung angreifen“ und ein „nicht-freiheitliches System“ errichten wollten. Die Antwort der Verfassung sei klar: „Eine Partei, die den Weg in die aggressive Verfassungsfeindschaft beschreitet, muss immer mit der Möglichkeit eines Verbots rechnen“. Dies war nicht nur eine abstrakte Warnung, sondern eine direkte Adressierung des Parteienverbots, des schärfsten Schwerts der Demokratie. Später bekräftigte er in seinem Appell an die etablierten Kräfte: „Mit Extremisten darf es keine politische Zusammenarbeit geben, nicht in der Regierung, nicht in den Parlamenten“.
Unterstützer wie die Publizistin Pina sahen in der Rede eine längst überfällige Aktion. Man sei froh, „einen Bundespräsidenten“ zu haben, der sich nach Monaten und Jahren gesellschaftlicher Unruhe positioniere. Die Aufgabe des Bundespräsidenten sei es, gesellschaftliche Debatten anzustoßen – ein Verweis auf die großen Reden seiner Vorgänger wie Richard von Weizsäcker oder Roman Herzog, dessen berühmte Ruck-Rede ebenfalls kontrovers war. Formal sei Steinmeiers Vorgehen ohnehin gedeckt. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2014, das die Äußerungen des damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck als zulässig erachtete, beweise, dass das Staatsoberhaupt „sehr große Freiheiten“ genieße, solange es um die Verteidigung der Demokratie gehe. Er müsse sich überparteilich, aber keinesfalls neutral verhalten.
Die Anklage der Spaltung: Die fatale Rhetorik der Ausgrenzung
Doch genau in dieser vermeintlichen Deutlichkeit liegt der Kern der Kritik. Die Journalistin Nena Brockhaus, selbst keine AfD-Sympathisantin, brachte die Gegenthese auf den Punkt: Die Rede sei „völlig daneben“, weil sie die Gesellschaft spalte und nicht einen würde. Der Bundespräsident sei der Präsident aller Deutschen – auch der Wähler der AfD.
Brockhaus’ zentrale Anklage ist von immenser politischer Brisanz: Indem Steinmeier derart scharf vor der AfD warne und indirekt jeden AfD-Wähler zur Zielscheibe der demokratischen Ächtung mache, sende er ein verheerendes Signal aus. „Er hat damit eigentlich jedem AfD-Wähler gesagt, dass derjenige kein Demokrat für ihn ist“. Angesichts von Umfragewerten, die die AfD bei 27 Prozent sehen, bedeutet dies, dass das Staatsoberhaupt einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung implizit aus dem Kreis der Demokraten ausschließt.
Das Resultat ist nicht etwa Einsicht, sondern Trotz und Rückzug. Die Menschen fühlen sich angegriffen, stigmatisiert und bevormundet. Die Rede wird nicht als wohlmeinende Mahnung verstanden, sondern als Maßregelung von oben, als die Aufforderung an „Demokraten“ – wie etwa die Talkshow-Gäste selbst – „beim Stammtisch oder auch im Fußballclub dafür [zu] werben, dass diese Menschen nicht mehr die AfD wählen“. Dies wird als Fingerzeig interpretiert: Zeigt mit dem Finger auf sie, überzeugt sie. Eine Rhetorik, die nicht auf Zusammenhalt setzt, sondern auf offene Konfrontation.
Der Boomerang-Effekt: Steinmeier als Mobilisierungschef der AfD
Hier liegt der tiefere, psychologische Fehler der präsidialen Attacke. Die vermeintliche Abrechnung des Bundespräsidenten mit dem rechten Lager ist in Wahrheit „kostenlose Wahlwerbung“. Jede Attacke aus dem höchsten Amt des Staates verfestigt das Narrativ der AfD, die sich seit jeher als Opfer eines korrupten „Altparteien“-Systems inszeniert.
Wenn der Bundespräsident, die moralische Instanz des Landes, die AfD zur Staatsfeindin erklärt, erfüllt er damit zwei Wünsche der Partei auf einmal:
-
Die Märtyrerrolle: Die AfD kann ihren Anhängern beweisen, dass „das Establishment“ Angst hat und zu unfairen Mitteln greift. Die Wähler fühlen sich nicht nur durch die Partei, sondern auch durch ihr Staatsoberhaupt verhöhnt und ungerecht behandelt, was zu einem Solidarisierungseffekt führt. Die Wut auf die „bevormundende“ und „undemokratische“ Mahnrede wird in noch größere Unterstützung für jene Partei umgemünzt, vor der gewarnt wurde.
Die Relevanz: Die Rede Steinmeiers zementiert die Position der AfD als die entscheidende Oppositionskraft, die derart wichtig ist, dass selbst das höchste Staatsamt sie adressieren muss. Dies ist ein unschätzbarer Wert in den Augen der eigenen Anhänger und unentschlossener Wähler, die die ständige Gängelei der etablierten Politik satt haben.
Brockhaus’ Fazit, es sei ein „Weihnachtsgeschenk an die AfD“, ist deshalb so treffend, weil es die politische Realität beschreibt: Die AfD befindet sich in einem Umfragehoch, das durch derartige moralische Brandmarkungen offenbar nicht gebrochen, sondern nur noch verstärkt wird. Ironischerweise hat der Hüter der Demokratie mit seiner Rede „ausgerechnet das Gegenteil erreicht“, als er beabsichtigte. Er hat den Wachstumsmotor der Rechten angeworfen.
Die Brandmauer-Debatte und der Kanzler-Konflikt

Steinmeiers deutliche Worte strahlen auch in die tagespolitischen Querelen aus. Seine klare Ansage, dass es keine Zusammenarbeit mit Extremisten geben dürfe, erschwert die ohnehin fragile „Brandmauer“ in den Ländern.
Während Bundeskanzler Olaf Scholz bewusst das Wort Brandmauer vermeidet und in der Union immer wieder Stimmen laut werden, die eine lokal begrenzte Zusammenarbeit mit der AfD für denkbar halten, legt Steinmeier den Parteien mit seinem präsidialen Machtwort eine unmissverständliche Richtschnur auf. Dieser Akt macht die Debatte um die „Challenge“ in der Union noch komplizierter, da sie nun nicht nur eine strategische, sondern auch eine moralische und präsidiale Komponente erhält. Obwohl Steinmeier das Wort „Brandmauer“ nicht explizit nannte, sind seine Aussagen als ultimative Betonung derselben zu verstehen, was die innerparteiliche Spaltung in der CDU/CSU weiter vertieft.
Der Radikale Ausweg: Die Logik des Stillen Abgangs
Aus all diesen Beobachtungen leitet sich die radikalste These ab: Wenn Steinmeier der „inoffizielle Mobilisierungschef“ der AfD geworden ist, dann ist die wirksamste Waffe gegen das weitere Erstarken der Partei sein eigener, stiller Abgang.
Der Bundespräsident, der sein Amt zur Verteidigung der Demokratie nutzt, muss die Konsequenz ziehen, dass seine Handlungen kontraproduktiv wirken. Es ist ein Akt der politischen Selbstlosigkeit, die eigene Figur vom Brett zu nehmen, bevor sie versehentlich die gegnerische Seite stärkt. Steinmeiers Rücktritt wäre nicht etwa ein Rückzug aus Schande oder Skandal, sondern ein „uneigennütziger Akt im Dienst der Demokratieverteidigung“.
Der Effekt wäre sofort spürbar: Der „Wachstumsbeschleuniger für die AfD“ wäre abgeschaltet. Der größte rhetorische Gegner, die moralische Autorität, die die AfD am liebsten attackiert und gegen die sie ihre Anhänger mobilisiert, wäre verstummt. Die Partei müsste sich neue Angriffsflächen suchen, die längst nicht so symbolträchtig wären wie das höchste Staatsamt.
Schlussbetrachtung
Frank-Walter Steinmeier hat einen großen Akt politischer Überzeugung vollzogen. Er sprach aus, was viele Demokraten dachten. Doch im polarisierten Klima des Jahres 2025 hat dieser Akt nicht die erhoffte Wirkung entfaltet, sondern eine Debatte über die Rolle des Bundespräsidenten und die strategische Bekämpfung des Rechtsextremismus ausgelöst, die das Land an seine Grenzen führt.
War seine Rede ein historischer Akt des Mutes, der in die Geschichtsbücher eingeht, oder ein fataler strategischer Fehler, der die Republik in eine Krise der Autorität stürzt? Die Tatsache, dass sein Rücktritt als ernstzunehmende, wenn auch radikale, politische Strategie diskutiert wird, zeigt die Tiefe der Verzweiflung im Kampf gegen den Aufstieg der extremen Rechten. Die unbequeme Wahrheit ist: Manchmal ist die beste politische Intervention die Enthaltung. Und manchmal ist die größte Tapferkeit, still zu gehen, um Größeres zu schützen. Die Republik blickt nun gebannt auf ihr Staatsoberhaupt, das ungewollt zum Zentrum eines nationalen Dilemmas geworden ist.