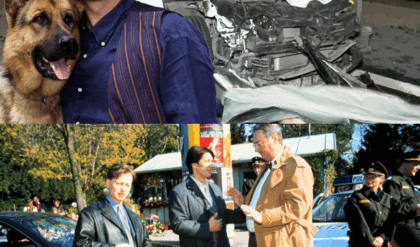Steinmeiers spaltende Rhetorik als SOS-Signal: Warum nicht die Demokratie, sondern die SPD in akuter Gefahr schwebt

Steinmeiers spaltende Rhetorik als SOS-Signal: Warum nicht die Demokratie, sondern die SPD in akuter Gefahr schwebt
Berlin – Die politische Debatte in Deutschland hat einen neuen, beunruhigenden Tiefpunkt erreicht. Ein Auftritt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der eigentlich der Einigkeit und der Würdigung der Verfassung dienen sollte, entfachte stattdessen eine hitzige Kontroverse über die Rolle des Staatsoberhaupts und den tatsächlichen Zustand der deutschen Demokratie. Anstatt zu kitten, so der einhellige Vorwurf aus Teilen des politischen Spektrums, habe der Bundespräsident gespalten. Die Analyse, die daraus in Expertenrunden wie der von Sandra Maischberger gezogen wurde, ist ebenso brisant wie unmissverständlich: Die eigentliche Bedrohung geht nicht von der Opposition aus, sondern von den etablierten Parteien selbst, deren Krise in der Rhetorik des Ausschlusses gipfelt.
„Ich fand die Rede völlig daneben“, resümierte die Journalistin Nena Brockhaus und brachte damit eine fundamentale Kritik auf den Punkt, die vielen Bürgerinnen und Bürgern auf den Lippen liegt. Die zentrale Frage, die Brockhaus aufwarf, war die nach der überparteilichen Pflicht des Bundespräsidenten: „Möchte überhaupt der Bundespräsident auch von AfD-Wählern sein?“.
Der Kern des Konflikts liegt in der Interpretation des Amtes. Ein Bundespräsident sollte für alle da sein, er sollte einen und „nicht weiter spalten“. Doch Steinmeier, so der Vorwurf, habe in seiner Rede so stark auf Spaltung gesetzt, dass er jedem AfD-Wähler implizit mitgeteilt habe, er sei „kein Demokrat für ihn“. In einem Land, in dem 27 Prozent der Bürger die AfD wählen, sei ein solches Signal eines angeblich überparteilichen Amtes nicht nur unverhältnismäßig, sondern zutiefst gefährlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
I. Die Titanic der SPD und der „Aktivismus“ des Staatsoberhaupts
Die schärfste und wohl zutreffendste Einordnung lieferte Fatina Keilani. Sie stellte die Frage nach der Bedrohung der Demokratie radikal infrage und drehte die Perspektive um: „Wer hier bedroht ist, ist eigentlich die SPD“.
Diese Schlussfolgerung basiert auf einer einfachen politischen Beobachtung: Die Sozialdemokraten verlieren die Wähler in Scharen, die „Verbindung zu denen verloren“. Die Wähler laufen weg „wie frisch gebackenes Brot“. Steinmeiers flammende Appelle zur Verteidigung der Demokratie klingen in diesem Kontext weniger wie eine staatstragende Notwendigkeit und mehr wie eine verzweifelte „SPD Rettungsaktion“, eine Parteinahme, die das Amt des Bundespräsidenten für einen parteipolitischen Kampf instrumentalisiert.
Das eigentliche Phänomen, so Keilani, sei nicht die Bedrohung, sondern die „Lebendigkeit“ in der politischen Bude. Nach Jahren der politischen Lähmung durch Große Koalitionen bringe die Opposition endlich wieder Leben und Streit in das Parlament, was „besser durchblutet als sonst“ sei. Andere Meinungen – insbesondere die konservativen – seien in der etablierten Politik nicht mehr gewünscht. Darin liege der Kern der Krise, nicht in der Existenz einer großen Oppositionspartei. Die Aufgabe des Bundespräsidenten, betonte Nena Brockhaus, sei es, „überparteilich zu sein, eben nicht aktivistisch im Sinne einer Partei“.
II. Der Giftpfeil der „Wehrhaften Demokratie“ und die Zerstörung des Pluralismus
Die Rede Steinmeiers, die bewusst die AfD meinte, ohne sie beim Namen zu nennen, gipfelte in einem Appell, der bei den Kritikern als Aufruf zur politischen Denunziation ankam. Steinmeier forderte die Bürger auf, sich einzumischen und den Mund aufzumachen – „im Parlament, beim Fußball, am Stammtisch, in der Schule, an der Bushaltestelle, am Arbeitsplatz“.
Dieser Aufruf, so die Interpretation, meine nicht den konstruktiven Dialog, sondern die Umerziehung der AfD-Wähler. „Die Demokraten die überall den Mund aufmachen sollen nur blöd, wenn das am Ende heißt alle, die das falsche sagen, sind automatisch keine“. Der Aufruf zum Einmischen werde in seinem Demokratieverständnis so interpretiert, dass nur diejenigen mitmischen dürfen, „die auf Parteilinie liegen“. Die Forderung der CDU-Bundestagsabgeordneten Nena Brockhaus lautete deshalb, Steinmeier hätte das Grundgesetz als große Klammer betonen und sagen müssen, dass „auch abweichende Meinungen, die nicht allen Leuten gefallen, trotzdem ihre Berechtigung haben“.
Professor Werner Patzelt, ein Mann der für seine messerscharfe Analyse bekannt ist, lieferte das intellektuelle Fundament zur Kritik an Steinmeier. Er betonte, es sei zwar Teil des Amtes, die „freiheitlich demokratische Grundordnung“ zu unterstützen, aber: „es gehört sich nicht, dass er zum Kampf gegen eine konkrete politische Partei auffordert, ohne sie beim Namen zu nennen“. Steinmeier habe lediglich die bürgerliche Politik der extremistischen Politik gegenübergestellt, um unterschwellig zu suggerieren, Extremisten seien nur die AfDler.
Indem er so vage bleibt, so Patzelts vernichtendes Urteil, „hat er einfach in den Nebel hinein geschossen“. Und das Ziel, das er dabei wirklich getroffen habe, sei nicht die AfD gewesen, sondern „die Prinzipienfestigkeit unserer pluralistischen auf Streit gegründeten Demokratie“. Der vermeintliche Verteidiger der Demokratie wird damit zum Angreifer auf deren Grundprinzip, indem er den politischen Pluralismus – den Kern einer wehrhaften Demokratie – selbst demontiert.
III. Die Brandmauer und die Lähmung der Regierung

Der Streit um die Brandmauer und die politische Ausgrenzung der AfD mündet unmittelbar in die Analyse der Handlungsunfähigkeit der aktuellen Regierung. Drei Viertel der Bevölkerung ist mit der Großen Koalition (Schwarz-Rot) unzufrieden. Diese Unzufriedenheit speist sich aus der Tatsache, dass die Regierung in ihrem Kampf gegen die Opposition ihre eigentliche Aufgabe vergisst: Problemlösung.
Nena Brockhaus beschreibt die Koalition als unfähig, über „Kleinkompromisse“ hinauszukommen. Es fehle das notwendige Vertrauen, um wirkliche Reformen anzustoßen, „die größer sind als die Einzelteile“. Die Folge sei eine „Opposition innerhalb der Koalition“, in der SPD und Union sich gegenseitig blockieren.
Die großen Sorgen der Bevölkerung, so die Expertenrunde, seien nicht Digitalisierung oder Nachhaltigkeit, sondern die „wirtschaftliche Existenz“, das „soziale Gefälle“ und die „ökonomische Lage“. Nur noch weniger als 30 Prozent der Bevölkerung hätten Zutrauen in die wirtschaftliche Lage des Landes. Die Politik jedoch ignoriert diese Realität und verharrt in der „Brandmauer-Ideologie“.
IV. Das Mauer-Paradoxon: Problemlösung oder Parteietikett?
Angesichts der Regierungslähmung brachte Nena Brockhaus eine ehrliche und pragmatische Debatte ins Rollen: die Frage nach der Minderheitsregierung. Sie argumentierte, eine Minderheitsregierung, die sich die Stimmen für Sachpolitik besorgen müsse, könne die Dinge nicht schlechter hinbekommen als die jetzige Koalition, in der sich die Partner permanent streiten.
Hier entzündete sich der Streit um die Brandmauer in ihrer reinsten Form. Die Frage war: Dürfen demokratische Parteien mit AfD-Stimmen abstimmen?
Brockhaus’ Antwort war ein Appell an die Sachlichkeit und die Wähler: „Die Bürger wollen Probleme gelöst kriegen und wenn die CDU und die AfD einen gleichen Punkt haben, dann sollen die gemeinsam abstimmen, ja“. Die Bürger sei es egal, „wer ihre Probleme löst, Hauptsache jemand packt es an“. Die politische Auseinandersetzung müsse sich auf die Sache konzentrieren und „nicht auf das Parteietikett“.
Doch die journalistische Gegenseite reagierte mit fast hysterischer Panik auf die bloße Idee. Die Tolerierung einer Minderheitsregierung durch die AfD sei „de facto am Ende eine informelle Koalition mit der AfD“. Diese Reaktion zeigt, wie tief die Brandmauer in den Köpfen sitzt und wie sie die Fähigkeit zur Sachpolitik zerstört. Man ist bereit, die wirtschaftliche Existenz des Landes und die Unzufriedenheit von drei Vierteln der Bevölkerung hinzunehmen, nur um den Kontakt zu einer unliebsamen Partei zu vermeiden. Die Ideologie des Ausschlusses triumphiert über den Pragmatismus.
Der Appell des Bundespräsidenten, der die Bürger zum Kampf gegen eine vermeintliche Bedrohung aufrief, entlarvte damit unfreiwillig die wahre Krise der deutschen Politik: Die Angst der etablierten Parteien vor dem Verlust der Macht ist so groß, dass sie die Prinzipien der pluralistischen Debatte opfern und die Handlungsfähigkeit des Staates lähmen. Das eigentliche SOS-Signal kommt nicht von Bellevue, sondern aus der Mitte der Gesellschaft: Die SPD ist in Gefahr, weil sie und ihre Koalitionspartner nicht mehr in der Lage oder willens sind, die existenziellen Probleme der Menschen zu lösen. Die Demokratie lebt – sie lebt im Streit und in der Zumutbarkeit des Andersdenkens – doch sie droht, an der Angst und der Lähmung ihrer eigenen Eliten zu ersticken.