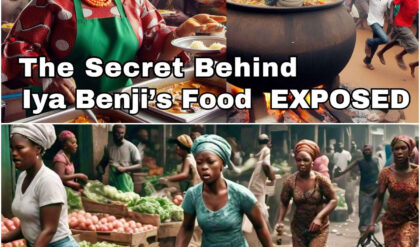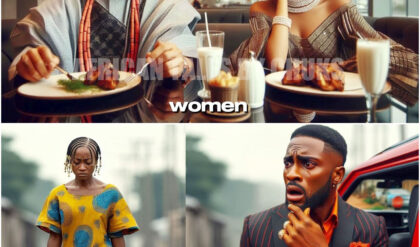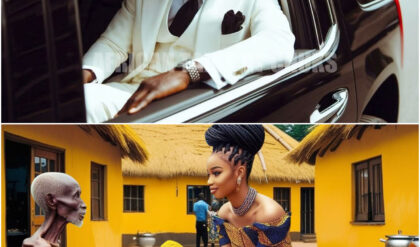Es gibt Momente im deutschen Fernsehen, die sind mehr als nur Unterhaltung. Sie sind ein Seismograph für die Stimmungen, die Ängste und die tiefen Gräben, die sich durch die Gesellschaft ziehen. Ein solcher Moment, festgehalten in einem viralen Clip, der millionenfach geklickt wurde, zeigt einen sichtlich auf 180 geladenen Wolfgang Bosbach. Der sonst so besonnene CDU-Politiker, bekannt für seine ruhige Analyse, verliert die Fassung. Sein Zorn richtet sich gegen ein Symbol, das an diesem Abend leibhaftig im Studio sitzt: eine vollverschleierte Frau, ein „Burka Gespenst“, wie es der Titel des Videos reißerisch nennt.
Der Eklat, der sich in dieser Talkrunde abspielte, ist ein Brennglas auf eine der wundesten Stellen der Nation: der Umgang mit dem politischen Islam, die Grenzen der Toleranz und die Frage, welche Werte nicht verhandelbar sind. Es war nicht nur ein Wutausbruch; es war eine chirurgische Zerlegung von Argumenten, die Bosbach und Millionen von Zuschauern offensichtlich nicht länger ertragen wollten.
Alles beginnt mit einer fast schon routinierten Frage an den erfahrenen Innenpolitiker. Man fragt ihn, ob er verstehen könne, warum die Frau im Studio so lebe, wie sie lebt – also vollverschleiert. Bosbach atmet tief ein. Man sieht ihm an, dass er nach Fassung ringt. Er beginnt diplomatisch: „Nein, das ist Ihre ganz persönliche Entscheidung, die habe ich nicht zu kommentieren, die habe ich nicht zu kritisieren.“ [03:29] Ein Satz, der die liberale Grundhaltung der Bundesrepublik widerspiegelt: Leben und leben lassen.
Doch dann kommt das große „Aber“. Und dieses „Aber“ hat es in sich. Es ist der Startschuss für eine Generalabrechnung. „Aber“, fährt Bosbach fort, „dass im Islam die Rolle der Frau eine wesentlich bessere ist als in unserer Gesellschaft, das ist für mich nicht nachvollziehbar.“ Es ist der Moment, in dem die diplomatische Zurückhaltung zerbricht und der Klartext beginnt.
Bosbach lässt es nicht bei einer pauschalen Behauptung bewenden. Er untermauert seine These mit zwei erschütternden Beispielen, die er, so sagt er, direkt von der Webseite des Islamzentrums München habe. Diese Beispiele sind es, die den Kern der Debatte treffen und die den Zuschauern den Atem stocken lassen.
„Gehen Sie mal auf die Homepage des Islamzentrums München“, fordert er die Runde auf . „Da sind so Fragen, häufige Fragen an den Islam. Unter anderem gibt es da eine Rubrik ‚Die Stellung der Frau‘.“ Sein erstes Beispiel: die Frage nach Gewalt in der Ehe. „Darf ein Moslem seine Frau schlagen?“ Bosbach macht eine dramatische Pause. „Wir würden dahinter schreiben: ‚Nein.‘ Dann käme die nächste Frage.“ Doch was er dort gelesen haben will, ist das genaue Gegenteil einer klaren Absage an häusliche Gewalt. „Dort wird ganz ausführlich erklärt, unter welchen Bedingungen er es nicht darf und unter welchen Bedingungen er es darf.“
Ein Raunen geht durch das Studio und die sozialen Medien. Eine theologische Legitimation für Gewalt gegen Frauen? In Deutschland, im 21. Jahrhundert? Bosbach schüttelt fassungslos den Kopf: „Wieso das frauenfreundlich sein soll, das kann mir keiner erklären.“ Er hat den Nerv getroffen. Er spricht aus, was viele als unerträgliche Relativierung von universellen Menschenrechten empfinden.
Doch er ist noch nicht fertig. Er legt nach. Zweites Beispiel: das Erbrecht. Wieder zitiert er die Quelle: „Da wird im Detail erklärt, warum es richtig ist, dass die Frau ein geringeres Erbrecht hat als der Mann.“ Wieder eine klare Benachteiligung, die in direktem Widerspruch zum deutschen Grundgesetz steht. Aber was Bosbach am meisten zu erzürnen scheint, ist nicht einmal der Fakt der Ungleichbehandlung an sich – so schlimm dieser sei –, sondern die ideologische Überformung, die damit einhergeht. „Ganz schlimm wird es dann“, so der Politiker, „wenn die Frauen sagen müssen: ‚Und das finde ich gut, dass ich ein geringeres Erbrecht habe als mein Mann.‘“
Hier, an diesem Punkt, entlarvt Bosbach die Perfidie eines Systems, das Unterdrückung nicht nur legalisiert, sondern sie den Unterdrückten als erstrebenswert und gottgewollt verkauft. „Die benachteiligte Frau muss es gut finden. Das ist für mich nicht nachvollziehbar.“ In wenigen Sätzen hat er das, was von manchen als kulturelle Eigenheit oder gar, wie der Sprecher im Video ironisch anmerkt, von „Gender-Studentinnen als Art von Emanzipation“missverstanden wird, als das entlarvt, was es für ihn ist: ein „Rückschritt“ , eine theologische Rechtfertigung für Ungleichheit.
Dieser furiose Vortrag ist jedoch nur der Auftakt. Der eigentliche Kern von Bosbachs Argumentation ist politisch. Er will eine rote Linie ziehen. Es geht ihm nicht um den Glauben des Einzelnen. Mit Nachdruck stellt er klar: „Es geht doch nicht um die religiöse Überzeugung eines Einzelnen. Es geht doch nicht darum, ob sie ihre Gebete verrichtet. Es geht nicht um die Speisevorschrift, es geht nicht um das Fasten. Das alles – die private Lebensentscheidung des Einzelnen.“
Das ist der Pakt, auf dem die Religionsfreiheit in Deutschland basiert. Ein Pakt, den Bosbach mit Nachdruck verteidigt. Doch dann definiert er den Punkt, an dem dieser Pakt gebrochen wird. „Die Trennlinie verläuft da, wo im Namen des Islam Rechte und Werte gepredigt oder vertreten werden, die im Widerspruch stehen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung unseres Landes.“
Und dann folgt der Satz, der wie ein Peitschenhieb durch die Diskussion fährt und der dem Video seinen eigentlichen Sprengstoff verleiht: „Und da kann ich nur sagen: Dieser politische Islam, der Islamismus, der Scharia-Islam gehört nicht zu unserem Lande!“ Es ist eine Kriegserklärung an eine Ideologie, die er als feindlich gegenüber der Freiheit betrachtet. Er warnt vor einer falsch verstandenen Toleranz, die zur Selbstaufgabe führt: „Toleranz ja, aber nicht Toleranz auch noch denen gegenüber, die gar nicht daran denken, uns gegenüber tolerant zu sein.“ Ein Satz, der zum Mantra für viele wird, die das Gefühl haben, der deutsche Staat sei zu nachsichtig gegenüber jenen, die seine Fundamente ablehnen.
Genau hier, bei der Rolle des Staates, entzündet sich der nächste Konflikt. Als ein anderer Gast, der Islamismus-Experte Ahmad Mansour, warnt, der Staat tue „viel zu wenig, um Radikalisierung zu verhindern“ , wird Bosbach erneut grundsätzlich.
Er wird konfrontiert mit Sorgen über die Radikalisierung von Muslimen in Deutschland. Und wieder explodiert der CDU-Politiker förmlich. Er dreht den Spieß um. „Sie machen sich Sorgen“, sagt er an seinen Gegenüber gewandt, „um die Radikalisierung der Muslime in einem Land, in dem es Tausende Moscheen und Gebetshäuser gibt. In einem Land, wo es Religionsfreiheit gibt, nicht nur für Christen.“
Er hält inne und stellt dann die eine Frage, die die gesamte Debatte über Doppelmoral auf den Punkt bringt: „Machen Sie sich eigentlich keine Sorgen um die Christen in Saudi-Arabien? Denen noch nicht mal das religiöse Existenzminimum gewährt wird?“
Es ist ein rhetorischer K.o.-Schlag. Bosbach zwingt die Diskussion, den Blick zu weiten und die Verhältnisse geradezurücken. Während in Deutschland über die Feinheiten der Religionsausübung und die Grenzen von Kritik gestritten wird, herrsche anderswo pure Intoleranz. Um seine Anklage zu visualisieren, nutzt er ein drastisches Bild: „Wir erlauben hier die Koranverteilungsaktion. Versuchen Sie mal mit einer Bibel nach Saudi-Arabien einzureisen! Sie hätten… die könnten keinen Fuß ins Land setzen.“
Diese Konfrontation enthüllt eine tiefe Frustration. Die Frustration über eine einseitige Toleranzforderung. Die Frustration über ein Wegsehen bei Verfolgungen von Christen und anderen Minderheiten in islamischen Ländern, während in Deutschland jede Kritik am Islam schnell als „islamfeindlich“ gebrandmarkt werde.
Der virale Clip ist mehr als nur ein „Ausraster“. Er ist ein Dokument des Widerstands gegen eine als verlogen empfundene Debattenkultur. Wolfgang Bosbach, der sonst so kontrollierte Taktiker, kanalisiert hier eine Wut, die weit über seine Person hinausgeht. Er leiht seine Stimme den Millionen, die im Stillen denken: „Endlich sagt’s mal einer!“
Die Debatte, so hitzig sie geführt wurde, lässt die Zuschauer mit fundamentalen Fragen zurück. Wo endet die Religionsfreiheit und wo beginnt der Angriff auf die Demokratie? Wie viel Intoleranz kann eine tolerante Gesellschaft aushalten, ohne sich selbst zu verraten? Und ist der deutsche Staat, wie Bosbach meint, „stark genug“ und handelt, „da, wo er eingreifen kann“ , oder schaut er, wie andere meinen, bei der schleichenden Radikalisierung in „90 Moscheen“ (oder mehr) zu lange weg?
Die Frau mit dem Nikab, das „Burka Gespenst“, hat an diesem Abend kaum ein Wort gesagt. Sie musste es auch nicht. Ihre reine Anwesenheit war der Katalysator für eine Debatte, die Deutschland noch lange beschäftigen wird. Sie war das Symbol, an dem Wolfgang Bosbach seine rote Linie zog – eine Linie zwischen dem privaten Glauben, den er schützt, und dem politischen Scharia-Islam, den er bekämpft.