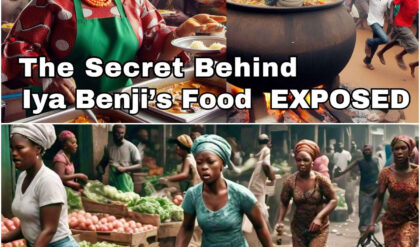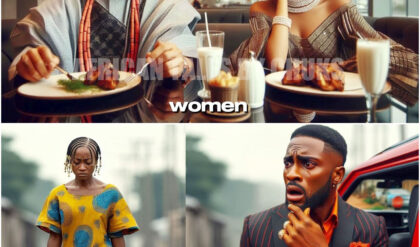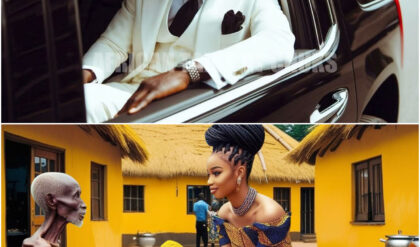Weidel im KKr*zfeuer: Wie die AfD-Chefin die Ang.ri.ffe von ZDF und ARD in einen Triumph verwandelte?

Es sind Momente, die für das Fernsehen gemacht zu sein scheinen. Ein Scheinwerfer, zwei Stühle, eine Politikerin und ein Journalist, der glaubt, die entscheidende Frage stellen zu können – jene Frage, die sein Gegenüber entlarvt, aus der Fassung bringt und vor einem Millionenpublikum bloßstellt. An zwei Abenden, kurz hintereinander, versuchten sich erfahrene Reporter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks genau daran. Ihre Zielperson: Dr. Alice Weidel, Co-Vorsitzende der Alternative für Deutschland (AfD). Doch was als mediale Demontage geplant war, entwickelte sich zu einem Lehrstück über Souveränität, Medienstrategie und die tiefe Kluft zwischen politischer Realität und ihrer Darstellung.
Der erste Akt spielte sich im ZDF Heute Journal ab. Die Atmosphäre war von Beginn an aufgeladen. Man spürte die Absicht des Reporters, Weidel nicht nur zu befragen, sondern sie moralisch zu richten. Der Dialog begann nicht mit einer Frage zur Sache, sondern mit einer direkten, persönlichen Konfrontation. „Aber Sie wirken, wenn ich das so sagen darf, und das hört man immer wieder von Menschen, die diese Rede mitverfolgen, auch zwischendurch immer wieder geradezu Hass erfüllt. Ist Ihnen das bewusst oder ist das Absicht?“, eröffnete der Journalist das Gespräch. Ein Paukenschlag, der keine Information suchte, sondern eine Emotion brandmarken sollte. Der Vorwurf des Hasses, pauschal und suggestiv in den Raum gestellt, sollte Weidel sofort in die Defensive zwingen.
Doch wer eine emotionale, vielleicht sogar wütende Reaktion erwartet hatte, wurde enttäuscht. Weidel reagierte mit einer fast schon irritierenden Gelassenheit. Anstatt den Köder zu schlucken und sich auf eine Diskussion über ihre angebliche Gefühlslage einzulassen, tat sie das Unerwartete: Sie ignorierte die Provokation und antwortete auf der Sachebene. Sie kontextualisierte ihre Rede als das, was sie war – eine Wahlkampfrede. Mit ruhiger Stimme legte sie ihre Kritik an der Politik der CDU dar, nannte konkrete Beispiele wie die Abholzung des Reinhardswaldes in Hessen für Windkraftanlagen oder die als „Turboeinbürgerung“ kritisierte Praxis in Berlin. Sie sprach nicht über Hass, sie sprach über Politik. Der Reporter lief ins Leere. Sein Versuch, das Gespräch auf eine persönliche Ebene zu ziehen, war gescheitert.
Doch er gab nicht auf. Das nächste Reizwort, das er zückte, war „Remigration“. Ein Begriff, der in der öffentlichen Debatte stark negativ konnotiert und untrennbar mit den Vorwürfen von Rechtsextremismus verbunden ist. „Dieser Begriff ist ja geprägt, gekapert von Rechtsradikalen und Neonazis“, erklärte der Reporter, um dann zu fragen, warum Weidel ihn nun „ganz explizit“ verwende. Wieder war die Falle offensichtlich: Weidel sollte in die Ecke gedrängt werden, sich für die Verwendung eines vermeintlich kompromittierten Begriffs rechtfertigen und sich bestenfalls von ihm distanzieren.
Weidels Antwort war ein weiteres Meisterstück der Gesprächsführung. Sie ließ sich das Deutungsmonopol über den Begriff nicht nehmen. „Ich lasse mir auch kein Stempel von außen von irgendwem aufdrücken, was er denn bedeuten könnte“, stellte sie klar. Dann definierte sie den Begriff aus ihrer Sicht: die konsequente Abschiebung von illegal im Land befindlichen Personen und Straftätern. Sie untermauerte ihre Position mit dem Verweis auf geltendes Recht und Gesetz und nannte dramatische Beispiele wie den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt oder den Attentäter von Mannheim. „Diese Menschen haben in diesem Land nichts verloren und dürften gar nicht hier sein.“ Der Reporter versuchte es erneut, insistierte auf der Verbindung zu Deportationen, doch Weidel blockte ab: „Ich habe Ihnen den Begriff erklärt. Es geht um Recht und Gesetz. Punkt. Ende der Diskussion.“ In diesem Moment war das Gespräch entschieden. Weidel hatte die Kontrolle vollständig übernommen und den Journalisten wie einen Anfänger aussehen lassen. Sein Versuch, sie mit moralischen Keulen zu treffen, war an ihrer sachlichen und unnachgiebigen Haltung zerschellt.
Der zweite Akt folgte in den ARD Tagesthemen, moderiert von Ingo Zamperoni. Auch hier wurde auf ein einleitendes Geplänkel verzichtet. Zamperoni ging sofort in den Angriff über. „Sie erheben einen Regierungsanspruch, aber keine Partei möchte mit Ihnen zusammenarbeiten. Ist der Kanzlerkandidatinnentitel nicht reiner Etikettenschwindel?“, lautete seine erste Frage. Er versuchte, die AfD von vornherein als isoliert und irrelevant darzustellen. Doch auch hier prallte der Angriff an Weidels souveräner Haltung ab. „Zunächst einmal wird das der Wähler entscheiden“, konterte sie trocken und verwies auf die Position der AfD als zweitstärkste Kraft in den Umfragen, weit vor den Parteien von Vizekanzler Robert Habeck und Kanzler Olaf Scholz. Sie drehte den Spieß um: Nicht die AfD müsse ihre Relevanz beweisen, sondern die etablierten Parteien müssten sich dem Willen der Wähler stellen.
Zamperoni wechselte das Thema zur Energiepolitik und warf der AfD eine „komplett rückwärtsgewandte Politik“ vor, da sie auf fossile Energien setzen wolle. Weidels Antwort offenbarte die Kernstrategie ihrer Partei: die Darstellung Deutschlands als Opfer einer ideologisch fehlgeleiteten Politik. „Deutschland ist der energiepolitische Geisterfahrer international“, erklärte sie. Während andere Länder auf einen Mix aus Kernkraft, Kohle und günstigem Gas setzten, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, preise sich Deutschland mit seiner Fokussierung auf Wind und Sonne aus dem Markt. Sie sprach von der „Absurdität und Doppelmoral“ einer Politik, die auf unzuverlässige Energiequellen setze und gleichzeitig von Atomstrom aus Frankreich abhängig sei.
Besonders provokant wurde es, als sie erklärte: „Wissen Sie, mir ist es völlig egal, woher das günstige Erdgas kommt.“ In Zeiten geopolitischer Spannungen ein bewusst gesetzter Tabubruch. Es gehe ihr allein um die Bürger und die heimische Wirtschaft, die unter den hohen Energiepreisen leiden. Sie zeichnete ein düsteres Bild eines Landes auf dem „absteigenden Ast“, in dem die Regierung durch hohe Steuern, CO2-Abgaben und das Verbot des Verbrennermotors die eigene Industrie zerstört.

Zamperonis letzter Versuch, Weidel in die Enge zu treiben, bezog sich auf eine Umfrage, laut der zwei Drittel der Unternehmen von ihren Verbänden eine klare Abgrenzung zur AfD fordern. Auch diesen Ball nahm Weidel auf und schlug ihn scharf zurück. Wirtschaftsverbände seien „parteipolitisch geprägt“, meist von der CDU. Die wahren Unternehmer, mit denen sie spreche, seien längst AfD-Wähler, trauten sich aber nicht, sich öffentlich zu bekennen, weil sie dann „durch den Kakao gezogen werden“. Eine kühne Behauptung, die das Bild einer schweigenden Mehrheit zeichnet, die nur auf den richtigen Moment wartet, um ihre politische Präferenz zu offenbaren.
Das Interview endete abrupt. Zamperonis „Danke fürs Gespräch“ klang gezwungen, sein Blick verriet Frustration. Wieder war der Plan nicht aufgegangen. Weidel hatte nicht nur die Angriffe pariert, sondern die Sendezeit genutzt, um die Kernbotschaften ihrer Partei effektiv zu platzieren: Kritik an der Regierung, an den etablierten Parteien und an den Medien selbst. Sie präsentierte sich als die einzige Stimme der Vernunft in einer von Ideologie getriebenen politischen Landschaft.
Diese beiden Interviews sind mehr als nur politische Auseinandersetzungen. Sie sind ein Symptom für den Zustand der politischen Debatte in Deutschland. Sie zeigen, wie tief die Gräben zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und einem erheblichen Teil der Bevölkerung geworden sind, der sich von der AfD vertreten fühlt. Die Journalisten agierten nicht als neutrale Fragensteller, sondern als Akteure mit einer klaren Agenda. Ihr Ziel war es, Weidel als extremistisch, hasserfüllt und inkompetent darzustellen. Doch durch ihre insistierende und oft als belehrend empfundene Art erreichten sie bei vielen Zuschauern das genaue Gegenteil: Sie bestätigten das von der AfD gezeichnete Bild einer voreingenommenen „Mainstream-Presse“ und machten Weidel zur souveränen Verteidigerin des gesunden Menschenverstandes.
Alice Weidel hat an diesen Abenden bewiesen, dass sie die Mechanismen der modernen Medienlandschaft perfekt beherrscht. Mit einer Mischung aus stoischer Ruhe, sachlicher Argumentation und gezielten Provokationen entwaffnete sie ihre Gegner und dominierte die Gespräche. Sie hat gezeigt, dass der Versuch, die AfD moralisch auszugrenzen, an Wirksamkeit verliert. Während die Reporter in ihren ideologischen Fallen gefangen blieben, sprach Weidel über die Themen, die viele Menschen im Land bewegen: Energiepreise, wirtschaftlicher Abstieg und Sicherheit. Am Ende standen zwei Journalisten, die ihre eigene Falle nicht kommen sahen und unfreiwillig zu den besten Wahlkampfhelfern für die Frau wurden, die sie eigentlich demontieren wollten.