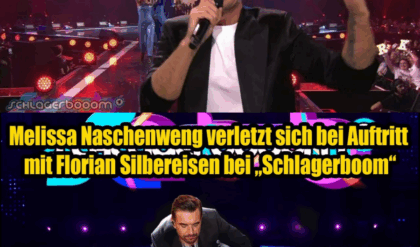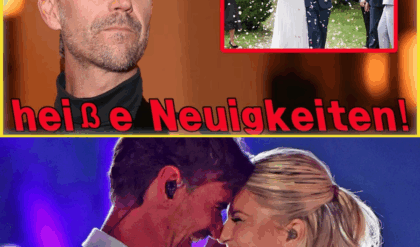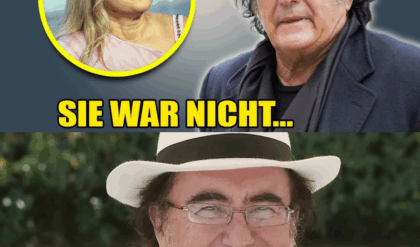Das gnadenlose Tribunal: Mit 68 Jahren rechnet Harald Schmidt ab – Das sind die fünf TV-Ikonen, die er am meisten verachtet
Jahrzehntelang war er der Mann, der aussprach, was Deutschland nur dachte. Sein Humor war nicht darauf ausgelegt, zu gefallen, sondern zu sezieren. Er agierte mit einer Schärfe, die einem Skalpell glich, und einer Intelligenz, die gefürchtet war. Harald Schmidt, der Altmeister der deutschen Ironie und des intellektuellen Zynismus, hat sich in die Annalen der Fernsehgeschichte eingebrannt. Er beherrschte die Kunst des kalten Lächelns, während er die Welt – und insbesondere die Medienschaffenden – gnadenlos auseinandernahm. Doch nun, mit 68 Jahren, zieht der Titan der Late-Night-Unterhaltung Bilanz. Und diese Bilanz ist keine liebevolle Retrospektive, sondern ein eiskaltes, vernichtendes Urteil.
Zum ersten Mal spricht Schmidt offen über eine Form der Ablehnung, die tiefer geht als bloße Kritik: die Verachtung. Es sind fünf Namen, fünf Ikonen des deutschen Fernsehens, deren Begegnungen so tief in seinem Gedächtnis und seiner Seele eingebrannt sind, dass er sie bis heute nicht vergessen kann. Die enthüllten Geschichten zeigen mehr als nur berufliche Rivalität; sie offenbaren einen fundamentalen Konflikt zwischen zwei unvereinbaren Weltanschauungen: Schmidts Forderung nach Haltung und Tiefe versus die Sehnsucht nach Lautstärke, Emotionalität und dem schnellen, konsumierbaren Lachen des modernen Entertainments.
Die von Schmidt entblößten Feindschaften sind ein Schlüssel zum Verständnis des Showgeschäfts. Sie zeigen, wo die Grenzen zwischen Kunst und Handwerk, zwischen Intellekt und Emotion verlaufen, und wie der Meister der Distanz auf jene blickt, die die Distanz zur Waffe gegen ihn machten.

Nummer 1: Stefan Raab – Der „Dosensuppen-Humor“ ohne Inhalt
Stefan Raab verkörperte lange Zeit den Inbegriff des modernen, chaotischen, aber genialen Entertainers. Für Harald Schmidt hingegen war er das personifizierte Gegenteil von allem, was er am Fernsehen schätzte. Während Schmidt das Publikum zum Denken bringen wollte, sah er in Raab lediglich einen Handwerker, der es zum unverbindlichen Lachen animierte. Die Kluft zwischen beiden war intellektueller Natur, doch sie eskalierte schnell auf persönlicher Ebene.
Der offene Konflikt entzündete sich, als Raab in seiner eigenen Show eine ganze Woche lang Witze auf Kosten von Schmidts als „verstaubt“ empfundenem Humor machte. Raab imitierte dessen Pausen, Gestik und Tonfall – und Millionen Zuschauer lachten mit. Als die beiden ein Jahr später bei einer Gala aufeinandertrafen, näherte sich Raab lässig und stichelte: „Na, Harald, lange nichts mehr im Fernsehen. Ich habe dich fast vergessen.“ Schmidts eisige Antwort ließ die Atmosphäre gefrieren: „Ich dich nie. Leider.“
Der Tiefpunkt der beiderseitigen Verachtung folgte bei einer Preisverleihung in Köln. Schmidt sollte einen Ehrenpreis überreichen – ausgerechnet an Raab. Die Inszenierung war als „Versöhnungsmoment“ gedacht. Was geschah, ging jedoch in die TV-Geschichte ein. Schmidt betrat die Bühne, hielt die Trophäe, sah Raab an und sagte mit einem Lächeln, das kälter war als jeder Januarabend: „Manche Preise werden nicht verdient. Sie passieren einfach.“ Als Raab danach griff, ließ Schmidt den Preis demonstrativ fallen, gefolgt von einem kurzen Knall des Mikrofons. Betretenes Schweigen im Saal. Später konterte Schmidt auf Raabs Aussage, er sei ein „Denkmal, das langsam verstaubt“: „Raab hat Humor wie Dosensuppe. Schnell heiß, aber ohne Inhalt.“ Zwei Welten, die sich nie verstanden und bis heute in eisiger Funkstille verharren. Für Schmidt steht Raab für die Oberflächlichkeit des Konsumfernsehens.
Nummer 2: Markus Lanz – Die Maske der Disziplin
Markus Lanz, der Inbegriff von Disziplin, Kontrolle und Ehrgeiz, verkörpert Eigenschaften, die Schmidt theoretisch schätzte. Doch bei Lanz empfand Schmidt sie als reine Fassade, als perfektionierte Maske, die die Tiefe vermissen ließ. Das erste Zusammentreffen in einer Talkshow zeigte die intellektuelle Unvereinbarkeit. Lanz agierte mit Fragen, die wie aus einem Lehrbuch schienen; Schmidt reagierte spöttisch, leicht überheblich, mit jenem kalten Lächeln, das sein Markenzeichen war. Lanz nahm die Spitzen persönlich.
Die Eskalation fand statt, als Schmidt selbst Gast in Lanz’ Sendung sein sollte. Auf die Bitte der Redaktion um Themenvorschläge, schrieb Schmidt kurz und bündig zurück: „Mein Thema ist Markus Lanz.“ Das folgende Interview war ein Desaster: Schmidt unterbrach ihn mehrfach, stellte eigene Gegenfragen und kommentierte Lanz’ Formulierungen live mit Spott, wie: „Das klingt, als hätten Sie es gerade auswendig gelernt.“ Lanz versuchte, seine Haltung zu bewahren, doch sein Lächeln erstarrte. Nach der Sendung resümierte Lanz, dass ein Gespräch mit Schmidt nur ein Duell sein könne. Schmidt verarbeitete diesen Gedanken in einer Kolumne: „Er hat recht, aber er war nicht bewaffnet.“
Die Verachtung Schmidts kulminiert in seinem finalen Urteil über den Moderator: „Lanz ist der Mann, der Stille mit Tiefe verwechselt.“ Es ist die Anklage des Intellektuellen gegen den Perfektionisten – die Verachtung für jenen, der Kontrolle über Authentizität stellt und dessen Ernsthaftigkeit in Schmidts Augen nur antrainiert erscheint.

Nummer 3: Hape Kerkeling – Die Verwechslung von Intelligenz und Kälte
Zwei Legenden, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Hape Kerkeling, der für Empathie, Wärme und Menschlichkeit steht, und Harald Schmidt, der für Distanz, Ironie und kalten Spott bekannt ist. Anfänglich mag es Respekt gegeben haben, insbesondere für Kerkelings Wandlungsfähigkeit. Doch die Begegnung, die alles veränderte, zeigte, dass diese beiden Seelen niemals auf einer Ebene schwingen konnten.
In einer Talkshow, in der Kerkeling sein neues Buch vorstellte, saß Schmidt überraschend im Publikum. Als er spontan zu einer Frage aufgerufen wurde, lieferte er einen Schlag, der unter die Haut ging: „Mich interessiert, ob Hape privat auch so spielt oder ob er irgendwann echt ist.“ Das Publikum lachte, doch Kerkeling blieb still und verließ nach der Sendung wortlos das Studio. Später konterte er in einem Interview: „Manche Menschen verwechseln Intelligenz mit Kälte.“
Die Feindseligkeit eskalierte bei einem Branchentreffen in Berlin. Kerkeling trat auf die Bühne, um einen Preis entgegenzunehmen, und begann seine Rede mit einer deutlichen Spitze gegen Schmidt: „Ich danke allen, die Humor nicht mit Überheblichkeit verwechseln.“ Die Kamera schwenkte auf Schmidt. Das berichteten Beobachter, stand der Altmeister sofort auf und verließ den Saal. Der endgültige Bruch kam 2014, als Schmidt backstage bei einem Jubiläum die gemeinsame Garderobe mit Kerkeling verweigerte. Schmidt lieferte die rationale Begründung für seine emotionale Ablehnung: „Hape hat ein großes Herz, aber keinen Filter. Ich bevorzuge Menschen, die denken, bevor sie fühlen.“ Es war eine gezielte Spitze gegen die Emotion, gegen die Verletzlichkeit, die Schmidt als Schwäche interpretierte. Seine Verachtung galt der fehlenden Ironiefähigkeit: „Kerkeling kann alles: singen, weinen, wandern. Nur eins nicht: ironisch sein.“ Kerkelings stiller Konter, er möge Menschen, die im Fernsehen über andere urteilen, weil es zeige, wie wenig sie noch über sich wüssten, war eine tiefsinnige psychologische Replik. Für Schmidt ist Kerkeling das Symbol für die Übermacht des Gefühls über den Verstand, ein absolutes Tabu in seiner Weltanschauung.
Nummer 4: Anke Engelke – Der Krieg um die Pointe
Anke Engelke und Harald Schmidt galten lange als das „Traumpaar“ des deutschen Fernsehens – witzig, klug, pontiert. Doch hinter den Kulissen ihrer gemeinsamen Arbeit verbarg sich ein ständiger, erbitterter Machtkampf. Hier galt Schmidts Verachtung nicht der Oberflächlichkeit, sondern der ungezügelten Spontaneität, die seine sorgfältig kalibrierten Mechanismen störte.
Der erste Knall ereignete sich in einer Live-Show, als Engelke spontan einen Sketch improvisierte, der Schmidts minutiös vorbereitete Pointe komplett überspielte. Das Publikum lachte lauter über Engelke als über ihn. Die Wut des Perfektionisten war immens; hinter der Bühne verharrte er stumm vor Wut in der Maske, während die Produktion um Schadensbegrenzung rang.
Die Situation eskalierte erneut während einer Probe, als Engelke ihn während eines Monologs unterbrach und forderte: „Lass mich mal, ich kann das spontaner.“ Ein Mitarbeiter erinnerte sich, Schmidt sei „wie gelähmt vor Wut“ aus dem Raum gestürmt. Der dritte offene Konflikt fand erneut bei einer Preisverleihung statt, als Engelke mit einer frechen Bemerkung über Schmidts als veraltet empfundenen Humor die volle Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zog. Schmidt soll in seiner Loge resigniert haben: „Wenn das Fernsehen nur noch Applaus zählt, bin ich fehl am Platz.“
Der finale Bruch kam, als Engelke in einem gemeinsamen Interview beiläufig erklärte, Schmidt sei „zu kontrolliert, um wirklich witzig zu sein.“ Diese Aussage, sofort von den Medien aufgegriffen, war eine direkte Kriegserklärung. Schmidts knappe, aber vernichtende Antwort: „Manche Menschen lachen über andere, weil sie selbst keine Pointe haben.“ Die Verachtung galt der mangelnden Wertschätzung für die schriftstellerische Arbeit, die penible Vorbereitung und die Überzeugung, dass wahre Komik nicht im Chaos, sondern in der präzisen Kontrolle der Sprache liegt.
Nummer 5: Jan Böhmermann – Der Respektlose Erbe
Wenn es jemanden gibt, der sich als den rechtmäßigen Erben Harald Schmidts sieht, dann ist es Jan Böhmermann. Doch genau dieser Anspruch war für Schmidt der tiefste Grund, ihn niemals zu akzeptieren. Böhmermanns Versuche, eine Brücke zu schlagen, wurden stets als provokanter Seitenhieb interpretiert.
Beim ersten Aufeinandertreffen bei einer Preisverleihung machte Böhmermann live einen Witz über Schmidts „alten Zynismus.“ Schmidt blieb äußerlich regungslos, soll aber hinter der Bühne vor Wut gebrannt haben, unfähig zu glauben, wie respektlos dieser junge Kollege sei. Die Talkshow-Konfrontation, bei der beide zu Gast waren, wurde zum Höhepunkt des Duells: Böhmermann unterbrach Schmidt wiederholt und kommentierte dessen Pointen mit einem spöttischen Lächeln, wodurch Schmidt gelähmt wirkte, unfähig, seinen gewohnten scharfen Humor auszuspielen.
In einem bitteren Radiospecial verbreitete Böhmermann die Behauptung, Schmidt habe „den Biss verloren“ und sei nur noch ein „Relikt vergangener Zeiten.“ Schmidts Konter in einer Kolumne war trocken und zutiefst beleidigend: „Er glaubt, Satire sei Lautstärke. Tatsächlich ist sie Haltung, und Haltung fehlt ihm.“
Die endgültige, öffentliche Eskalation erfolgte bei einer Gala, als Böhmermann Schmidt mit den Worten vorstellte: „Hier ist der Mann, der mich inspiriert hat, ohne es zu wissen.“ Schmidts kühlstmögliche Replik war ein Schlag ins Gesicht des selbsternannten Erben: „Inspiration kann man nicht essen. Ich bevorzuge Resultate.“ Böhmermann steht für Schmidt nicht nur für eine mangelnde Haltung, sondern auch für eine neue Generation der Lautstärke, die das differenzierte, intellektuelle Spiel des Zynismus durch plakative Provokation ersetzt hat.

Ein Vermächtnis aus Distanz und Verachtung
Die Offenbarung dieser fünf tief verwurzelten Verachtungsmomente ist mehr als ein Klatsch aus der Medienwelt. Es ist Harald Schmidts abschließendes, kompromissloses Vermächtnis. Jeder der fünf Namen – Raab, Lanz, Kerkeling, Engelke, Böhmermann – steht für eine Eigenschaft oder Entwicklung im deutschen Fernsehen, die der Altmeister der Ironie zutiefst ablehnt: Oberflächlichkeit, das Vertauschen von Fassade und Tiefe, ungefilterte Emotionalität, die Glorifizierung der Spontaneität und der Mangel an wahrer intellektueller Haltung.
Schmidt verabscheut, was er als Verfall der Satire zur reinen Selbstinszenierung und als Beifall heischende Lautstärke betrachtet. Er bleibt der unversöhnliche Puritaner der Ironie, der nichts so sehr verabscheut wie die Wärme, die Menschlichkeit und die unkontrollierte Emotion, die das zeitgenössische Fernsehen dominieren. Sein Rückblick auf diese fünf Duelle ist der Beweis, dass Harald Schmidt, selbst mit 68 Jahren, seiner eigenen, kompromisslosen Haltung treu bleibt. Er hat das Spiel nie gespielt, um Freunde zu gewinnen, sondern um die Wahrheit, wie er sie sah, mit maximaler Schärfe auszusprechen. Die Liste der Verachteten ist somit ein letzter, intellektueller Triumph über die seichte Welle des Entertainments. Sie ist sein kaltes, meisterhaftes Abschlussurteil über eine Branche, die er maßgeblich geprägt hat – und die er, in ihrer heutigen Form, zutiefst ablehnt. Die einzige Frage, die am Ende bleibt, ist die: Wer würde wohl auf der Liste derer stehen, die ihn am meisten verachten?