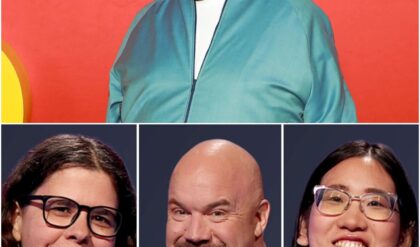Wenn es um den Islamismus und die tief sitzende Problematik der Radikalisierung geht, scheut sich die gesellschaftliche und politische Elite oft davor, das Kind beim Namen zu nennen. Zu groß ist die Angst vor Stigmatisierung, zu tief die Verankerung des Narrativs, das Problem liege primär in der sozialen Ausgrenzung oder im Internet. Doch Hamed Abdel-Samad, einer der profiliertesten und unerbittlichsten Islamkritiker der Gegenwart, hat diese beschwichtigende Fassade in einer brisanten Fernsehdebatte auf spektakuläre Weise zum Einsturz gebracht. Seine Thesen sind scharf, provozierend und zutiefst emotional aufgeladen, weil sie nicht nur die Radikalen, sondern auch jene „moderaten“ Glaubensgemeinschaften in die Pflicht nehmen, die er für mitschuldig hält.
Abdel-Samad bringt es auf den Punkt: Das Problem liegt nicht an der Gesellschaft, sondern „tief in dem Islam selbst“. Er fordert, endlich die innerislamischen Probleme zu thematisieren, denn genau dort, an den Wurzeln der Ideologie, beginne die Krise. Seine Argumentation entfaltet sich zu einem schonungslosen Frontalangriff auf die vermeintliche Trennung zwischen frommer Tradition und gewalttätigem Extremismus. Dies ist der ungeschminkte Bericht über eine Konfrontation, die die Wahrheit über den Terror ans Licht bringt und eine Debatte in Gang setzt, die Deutschland längst hätte führen müssen.

KAPITEL I: Das große Fragezeichen über dem „gemäßigten“ Islam
Der Kern der Kontroverse liegt in Abdel-Samads polarisierender These: Es gibt zwar viele friedliche und „gemäßigte Muslime“, die ihren Glauben in Einklang mit der westlichen Lebensweise praktizieren, doch der Islam als politisches und juristisches Regelwerk enthält Elemente, die per definitionem nicht gemäßigt sind [07:05].
Er verwehrt sich vehement gegen die Idee, dass man den Terror besiegen könne, indem man die Religion schönredet und die problematischen Elemente leugnet. Abdel-Samad sieht die Ursache des Konflikts in einer gefährlichen nostalgischen Verklärung: die „Faszination Welteroberung“ und die romantische Sehnsucht nach dem 7. Jahrhundert [05:05, 07:13]. Das, was in Moscheen erzählt werde, sei der Beginn der Radikalisierung: die Verherrlichung der Zeit, als „wir mal richtige Muslime waren“, die die Welt beherrschten [07:26]. Diese Rückbesinnung auf ein ahistorisches, idealisiertes Kalifat ist für ihn nicht Tradition, sondern der mentale Nährboden für Extremismus.
Die Auseinandersetzung erreicht ihren Höhepunkt, als eine Diskussionspartnerin, die der Titel als „freche Islamistin“ tituliert, ihm ein „besonders großes Fragezeichen“ attestiert [05:05]. Sie wirft ihm vor, mit seiner These, es gebe keinen gemäßigten Islam, den Extremisten in die Hände zu arbeiten. Sie argumentiert, er bestärke Jugendliche in der fatalen Annahme, dass sie als Muslime in der westlichen Gesellschaft niemals ankommen oder akzeptiert würden [05:40]. Für sie ist Abdel-Samads offene Kritik der Verrat, der die Spaltung erst vertieft.
Abdel-Samad jedoch kontert mit der Erfahrung der Entfremdung, die nicht durch seine Kritik entsteht, sondern durch die Lehren der Glaubensgemeinschaften selbst. Er lässt sich nicht in die Ecke des Extremisten stellen – ein typischer Reflex, den er als „lächerlich“ abtut [05:50]. Für ihn ist die Weigerung, die bevormundenden und übergriffigen Elemente der islamischen Rechtsprechung und Politik zu reformieren, der wahre Verrat an den jungen Muslimen in der Diaspora.
KAPITEL II: Die Entmenschlichung: Wenn der Ungläubige schlimmer ist als ein Tier
Der schockierendste Teil von Abdel-Samads Analyse betrifft die Rolle der islamischen Glaubensgemeinschaften in Deutschland, Österreich und weltweit. Entgegen der offiziellen Darstellung, die Religion sei nur ein Vorwand für soziale Außenseiter, macht er die Moscheen und Dachverbände für die innere Vorbereitung auf die Radikalisierung verantwortlich [03:57].
Er beleuchtet einen schleichenden, moralischen Prozess: die Entmenschlichung des Ungläubigen. Abdel-Samad kritisiert, dass in den Moscheen der Begriff des Kafir (Ungläubiger) salonfähig gemacht wurde [04:07]. Er zitiert die verheerende Botschaft, die im Koran verankert sei: „Ungläubiger […] ist schlimmer als ein Tier“ [04:14]. Diese moralische Mauer, die zwischen den jungen Muslimen und der hiesigen Gesellschaft errichtet werde, ist für ihn der eigentliche Beginn der Entfremdung [04:27].
Diese Entfremdung äußert sich im Gefühl der Unreinheit. Die Jugendlichen bekommen ständig angeflüstert, dass die westliche Lebensweise „unislamisch und somit unrein und schmutzig“ sei [04:37]. Sie fühlen sich in ihrem Heimatland nicht zu Hause, weil ihr Glaube angeblich nicht „richtig praktiziert“ werden kann [04:47]. Diese moralische Isolation ist der kritische Moment: Sie bereitet den Boden für die Extremisten, die daraufhin mit der Faszination des „ahistorischen islamischen Staates“ und des 7. Jahrhunderts werben [05:05]. Abdel-Samad argumentiert, dass die Moscheen, indem sie die Entmenschlichung billigen oder dulden, ungewollt die Tür für die dschihadistische Propaganda öffnen.
KAPITEL III: Der Trugschluss des „Jihad zur Schule gehen“
Die Diskussion um den Begriff Jihad ist ein weiteres zentrales Schlachtfeld, auf dem Abdel-Samad die Verharmlosung scharf kritisiert. Wenn er höre, „das hat überhaupt mit dem Islam nichts zu tun und Jihad bedeutet zur Schule gehen“, dann fühlten sich viele Menschen „verarscht“, entschuldigt er sich [03:39].
Er weiß, dass die sogenannte „große Jihad“-Erzählung (der Kampf gegen das eigene Ego) zwar existiert [09:00], aber in der politischen Realität die Faszination für den „kleinen Jihad“ – den Kampf für die Sache Gottes und die Sehnsucht nach Welteroberung – die Oberhand gewinnt [09:00].
Abdel-Samads knallharte Frage, die die gesamte Debatte dominiert, ist diese: Warum hören wir nicht von jungen Ukrainern oder Afrikanern, die Menschen enthaupten, obwohl es in ihren Regionen Konflikte gibt? [08:12]. „Warum ist es immer, wenn es um Selbstmordattentäter geht, geht es dann um Muslimen?“ [08:19]. Seine Antwort ist eindeutig: weil das Martyrium und der Jihad in den Moscheen nicht verpönt, sondern vielmehr geduldet oder implizit glorifiziert werden [08:27]. Auch der Begriff des Kalifats werde nicht ausreichend abgelehnt [08:36].
Hier fordert er eine schonungslose Selbstkritik. Statt „PR für den Islam“ zu betreiben, müssten die muslimischen Intellektuellen und Gemeinschaften endlich den „Abbruch […] mit diesen Traditionen“ wagen [07:43, 02:03]. Nur wenn diese ideologischen Stützpfeiler des Extremismus von innen heraus fallen, kann die Radikalisierung gestoppt werden.
KAPITEL IV: Die militärische und moralische Niederlage
Als Lösung für den militanten Islamismus bringt Abdel-Samad eine radikale und unpopuläre Strategie ins Spiel. Er beruft sich auf die Art und Weise, wie Deutschland und Japan vom Faschismus befreit wurden [00:48]. Seine Schlussfolgerung: Man besiegt den Faschismus nicht nur durch Bildung, Prävention oder Dialog.
„Erst mussten die Faschisten zerbombt, eine militärische und moralische Niederlage, vernichtende Niederlage erleiden“ [01:05], so Abdel-Samad. Nur danach konnte ein Marshall-Plan folgen, der den ideologischen Wiederaufbau ermöglichte. Er überträgt diese Strategie auf den militanten Islamismus.
Seine Forderung ist klar: Dialog und Beten reichen nicht [03:00]. Es braucht klare Kante, Bodentruppen und die „Opferbereitschaft“ der westlichen Mächte [01:28, 01:38]. Er kritisiert, dass der Westen oft einen „sauberen Krieg“ führen wolle, ohne die notwendigen personellen Verluste in Kauf zu nehmen. Nur durch eine vernichtende militärische Niederlage kann der militante Islamismus weltweit besiegt werden.

SCHLUSSFOLGERUNG: Die Wahrheit, die aufrütteln muss
Hamed Abdel-Samad stellt in dieser Debatte nicht nur Fragen, er liefert eine schmerzhafte Diagnose der innerislamischen Zustände und eine knallharte Therapieempfehlung für den Westen. Er entlarvt die Ausflüchte und die „Schönrednerei“ und zwingt die Zuhörer, sich der unbequemen Realität zu stellen: Die Wurzeln des Terrors sind nicht rein sozioökonomischer Natur, sondern liegen tief in den religiös-politischen Elementen einer Ideologie, die die Entmenschlichung der Ungläubigen duldet.
Sein Ruf nach einer militärischen und moralischen Niederlage des militanten Islamismus und die Forderung nach einem fundamentalen Bruch mit gefährlichen Traditionen in den muslimischen Gemeinschaften sind ein Weckruf. Es ist der Aufruf, endlich „das Kind beim Namen zu nennen“ [07:52] und die Debatte nicht länger durch die Brille der Political Correctness zu filtern. Nur so, schließt Abdel-Samad, kann verhindert werden, dass die Faszination für das 7. Jahrhundert weiterhin das Schicksal des 21. Jahrhunderts bestimmt.