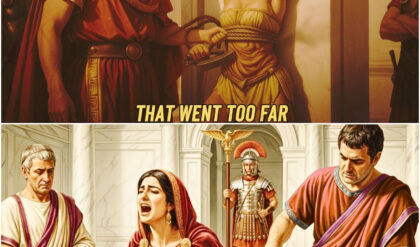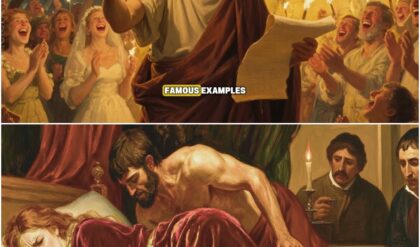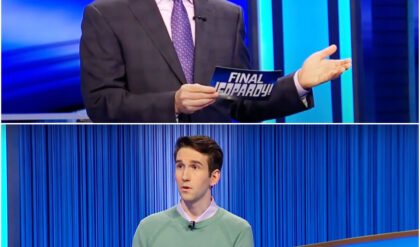In dieser Phase ihres Lebens steht Suzi Quatro, die unbestrittene Rock-Pionierin, nicht am Ende einer glorreichen Karriere, sondern am Rande einer Geschichte, deren Wahrheit tiefer und schmerzhafter ist, als es jeder Bühnenblitz vermuten ließe. Sie, die Lederkriegerin, die die gläserne Decke im Rock ‘n’ Roll für Frauen durchbrach und Hits wie „Can the Can“ in die Gehörgänge der Welt hämmerte, enthüllt eine stille Tragödie, die das Fundament ihres Ruhms untergräbt: die Akkumulation von Verlust, ungesühnter Schuld und dem gnadenlosen Verrat des eigenen Körpers. Was sie jetzt enthüllt, ist jenseits von herzzerreißend – es ist eine Lektion über den immensen Preis, den eine Frau für die Vorreiterrolle in einer von Männern dominierten Welt bezahlen musste.

Von der Schlagader Detroits zum einsamen Ruhm Londons
Susan Kattro wurde in den ruhigen, aber musikalisch pulsierenden Vororten Detroits geboren, einem Schmelztiegel aus Motown-Soul und rauen Rock-Garagen. Ihr Vater, Art Quatro, ein ungarisch-italienischer Jazzmusiker, formte ihre Arbeitsmoral nicht mit Zuckerbrot, sondern mit der Disziplin eines Mannes, der wusste, dass Musik sowohl Fleisch und Blut als auch ein gnadenloser Verschlinger sein kann. Er lehrte sie, dass die harte Arbeit über dem vergänglichen Ruhm stand. In diesem Haushalt, zwischen ihren vier Geschwistern, darunter ihre Schwestern Patty und Al, mit denen sie später die bahnbrechende Band The Pleasure Seekers gründen sollte, lernte die junge Susi, den Bass zu umarmen.
Dieses Instrument war für sie mehr als nur ein Rhythmusgeber; es war ihr „einziger Freund, der die Einsamkeit verstand“, wie sie später in ihrem Dokumentarfilm flüsterte. Die Rock-Ära in Detroit war für Mädchen, die Instrumente spielten, ein gnadenloses Pflaster. In den Garagen-Proben vermischte sich das Lachen ihrer Schwestern oft mit Tränen, weil sie als “Bassmädchen” verspottet wurden. Mit The Pleasure Seekers coverte sie die Rolling Stones in der Cobohall und stellte sich dem Applaus, der mit spöttischen Pfiffen gemischt war: „Ihr könnt ja nur mit dem Hintern wackeln“. Jeder dieser höhnischen Kommentare schmiedete den unnachgiebigen Lederpanzer, den Susi später tragen sollte, aber jeder Schnitt hinterließ auch eine Narbe auf ihrem jungen, stolzen Herzen. Die Single „Water Way to Die“ war ihr rebellischer Schrei, doch der lokale Erfolg war nur ein Flackern vor dem Sturm des rauen Marktes.
Als die Band zerfiel und das Schicksal in Form des Produzenten Mickey Most nach London rief, war es ein Durchstoß des Abschieds. Most sah das Feuer in ihren Augen und beschrieb, dass dieses kleine Mädchen den Bass „wie eine Amazone“ hielt. Susi verließ Amerika mit einem Koffer voller selbstgenähter Lederoutfits und kehrte ihrer Familie den Rücken, unwissend, dass sie ihre Jugend und vor allem ihre Zukunft als Mutter für immer gegen den Ruhm eintauschen würde.
Der höchste Gipfel des Ruhms und der tiefste Fall der Mutter
London, die Hauptstadt des Glam Rocks, empfing sie mit einer Mischung aus Neugier und Kälte. Doch mit dem donnernden Stampfen von „Can the Can“ explodierte Suzi Quatro. Ihr Image – der eng anliegende schwarze Lederanzug, der strahlend weiße Precision Bass, der kantige Bob – wurde nicht nur zu einem Hit, sondern zu einer Kriegserklärung. Sie war die erste Frau, die es wagte, in dieser männerdominierten Arena so hart, so laut, so kompromisslos zu sein. Über 50 Millionen verkaufte Platten, ausverkaufte Touren in Europa, Japan verehrte sie als Idol. „Ich bin hier und ich werde mich nicht unterkriegen lassen“, brüllte sie in die Welt.
Doch unter dieser Oberfläche verbargen sich Risse. Hinter den Lichtern lagen herzzerreißend einsame Hotelnächte, in denen sie unter Tränen zu Hause anrief. „Mama, ich vermisse euch alle, ich habe meine Seele für den Ruhm verkauft“, schrieb sie in ihrer Autobiografie Unzipped. Und während in Europa Hits wie „Devil Gate Drive“ dominierten, weigerten sich in ihrer Heimat Amerika Radiosender, sie zu spielen, nannten sie zu „maskulin“. Erst das Duett „Stumblin’ In“ mit Chris Norman brachte den späten, bitteren Sieg, indem es in die Charts vordrang.
Die tiefste Wunde sollte jedoch nicht durch die Industrie, sondern durch die Mutterschaft geschlagen werden. Sie heiratete den Gitarristen Len Tuckey, den einzigen Mann, der „ihren Rock and Roll Herzschlag verstand“. Doch die Realität der unaufhörlichen Tourpläne war wie ein Messerstich. Als Tochter Laura zur Welt kam, sah Susi ihr Kind nur für kurze Zeit durch die Krankenhausscheibe, bevor sie wieder in ein Flugzeug stieg, um die Tour fortzusetzen. Dieses Bild – die Augen ihres Kindes, das sie wie eine Fremde anstarrte – verfolgte sie für immer. „Ich sang meinem Kind Schlaflieder über das Telefon aus Tokyo“, erinnerte sie sich mit Tränen. „Jedes Mal, wenn mein Kind fragte, wo ist Mama, starb ein Teil von mir.“
Die Geburt von Sohn Richard mitten in einer Tour war nicht anders. Susi kam erst nach Monaten nach Hause. Er lernte mit dem Kindermädchen laufen und nannte eine fremde Frau „Mama“, bevor er seine leibliche Mutter erkannte. Der höllische Zeitplan erlaubte es ihr, ihre Kinder nur wenige Monate im Jahr zu sehen. Aus Angst vor dem schlechten Gewissen machte Susi ihre Kinder zu „Requisiten“, um es wieder gut zu machen, nur um Laura inmitten von zehntausenden Zuschauern panisch schreien und Richard sich vor Angst in die Hose machen zu sehen. Die Tragödie mit ihren Kindern, die tiefste Wunde, hatte die Mutterseele in ihr zerrissen.

Die Hölle der Scheidung und das Echo des Hasses
Der tragische Höhepunkt dieser familiären Entfremdung war die Scheidung von Len Tuckey. Es war keine Trennung, es war die Hölle, in der Möbel zersplitterten und die angestaute Verzweiflung der Familie explodierte. Tochter Laura schrie ihre Mutter an: „Du bist eine Verräterin an der Familie.“ Richard hämmerte weinend gegen seine Tür. Die schrecklichsten Worte aber kamen von Len, der seinen Ehering warf und brüllte: „Du hast ihre Kindheit getötet“. Susi kniete nieder, umklammerte die Beine ihrer Kinder und flehte um Vergebung. Doch Laura drehte sich kalt ab, und Richard rannte seinem Vater mit hasserfülltem Blick nach.
Was folgte, war ein Jahrzehnt der schmerzhaften Entfremdung. Laura verweigerte lange Zeit jeden Anruf und schickte nur kühle Briefe. Die tiefste Wunde aber schlug Richard, der als Teenager den Drogen verfiel. Ein Anruf aus einer Entzugsklinik lieferte das vernichtende Urteil: „Mama, ich hasse dich dafür, dass du mich verlassen hast“. Auf jeder Bühne, bei jedem Applaus, sah Suzi ins Publikum und erblickte nicht die Gesichter ihrer Fans, sondern die ihrer Kinder, die ihr nicht verziehen hatten. „Ich hatte Erfolg bei der Welt, aber ich habe bei dem Fleisch und Blut, das ich geboren habe, versagt. Das ist die größte Tragödie meines Lebens“, gestand sie mit gebrochener Stimme.
Der Verrat des Körpers und die Kette des Verlusts
Die Kette der Tragödien riss nicht ab. Sie begann mit dem Verlust des Leuchtturms ihrer Jugend: ihrer Mutter Helene. Während Helene gegen Magenkrebs kämpfte, besuchte Susi sie aufgrund ihres höllischen Tourplans nur selten. Der letzte Anruf – „Susan, komm nach Hause, ich bin so müde“ – wurde mit einer „tödlichen Lüge“ beantwortet: „Nur noch eine Tour, Mama“. Susi kam viel zu spät. Sie küsste den kalten Sarg und flüsterte die Worte, die sie nie laut gesagt hatte: „Es tut mir leid, dass ich dich nicht oft genug umarmt habe“.
Der zweite Messerstich, der bis auf die Knochen ging, war der Tod ihrer Schwester Patti Quatro, ihrer Kameradin aus den Pleasure Seekers-Tagen, die an Brustkrebs starb. Susi sagte Shows ab, um nach Detroit zu fliegen, kam aber am Sterbebett nur noch rechtzeitig an, um die Hand ihrer Schwester zu halten und unter Tränen „What a Way to Die“ zu singen. Jetzt, da auch Vater Art gestorben war, war Suzi die „letzte Überlebende der Quatro-Dynastie“.
Doch die härteste Prüfung sollte der Verrat des eigenen Körpers sein. Der Missbrauch von Schmerzmitteln führte zu einer Codein-Abhängigkeit, die ihre Leber von innen zerfraß. „Ich schluckte die Pillen wie Bonbons, um auf die Bühne zu kommen“, gestand sie. Das tausendfache Stampfen bei Can the Can forderte seinen Tribut in Form einer schweren Bandscheibendegeneration in der Wirbelsäule, die den Ärzten zufolge eine Lähmung zur Folge haben konnte. Aufhören bedeutete sterben, also lernte sie nach schmerzhaften Operationen wieder das Laufen.
Der verheerendste Schlag kam jedoch durch eine schwere Infektionskrankheit. Wochenlang lag sie im Krankenhaus, mit Atemnot, die sich anfühlte wie ein Vorschlaghammer auf ihrer Brust. Sie überlebte, doch die schrecklichen Folgen blieben: chronische Erschöpfung, die sie viele Stunden täglich schlafen lässt, und der größte Schlag für eine Musikerin: ihre rechte Hand zittert so stark, dass sie den Bass kaum noch halten kann. Ihr Kurzzeitgedächtnis versagt, sie vergisst Liedtexte, die sie jahrzehntelang auswendig kannte. „Ich übe sechs Minuten Bass und muss mich zwei Stunden hinlegen“, klagte sie.

Der letzte Akkord: Unsterblich, aber zerbrechlich
In dieser späten Phase, im Angesicht dieser physischen und emotionalen Zerstörung, weigert sich Suzi Quatro jedoch zu sterben. Die Rückkehr war kein Wunder, sondern der tägliche, schmerzhafte Kampf einer schwerverletzten Kriegerin. Ihr Album Face to Face brachte das Rock-Biest zwar zurück, doch beim Videodreh zitterten ihre Hände so sehr, dass viele Takes nötig waren.
Die jüngsten Tourneen sind der tragischste Beweis ihrer unsterblichen, aber zerbrechlichen Vitalität. Die Shows waren zwar ausverkauft, aber Susi musste mitten in der Setlist auf einem Stuhl sitzen; die Bass-Soli wurden gekürzt. Das Publikum sang die Höhepunkte für sie. Sie postete ein Trainingsvideo, das ihre zitternden Hände zeigte, die die Basssaiten mit medizinischem Klebeband fixieren mussten. Jüngst musste sie Shows wegen Blutdruckabfalls absagen und Infusionen am Flughafen erhalten.
Ihr Ehemann, der deutsche Konzertveranstalter Rainer Haas, ist ihre Stütze, der mit medizinischem Equipment und Aufmerksamkeit zu jeder Tour fliegt. Er hält ihre Hand, während sie mit ihrem ikonischen weißen Precision Bass kämpft. Und während sie gegen ständige Gerüchte über ihr Ableben in den sozialen Medien ankämpft – „Begrabt mich nicht so früh“ –, offenbaren ihre Gedanken über Reinkarnation und Tod ihre geistige Zerbrechlichkeit: „Ich glaube, im nächsten Leben werde ich mit Paty und Mama Bass spielen. Ohne Schmerz, ohne Trennung“.
Suzi Quatros Reise ins Alter, auf einem Stuhl sitzend, siegreich, aber zitternd, ist die ultimative Tragödie. Sie kämpft nicht mehr um Geld oder Ruhm. Sie kämpft, weil der Bass ihr „Fleisch und Blut“ ist und ihn loszulassen „bedeutet, meine Seele loszulassen“. Die Welt schuldet Suzi Quatro eine Entschuldigung: für die einsamen Nächte am Telefon, in denen sie ihren Kindern Schlaflieder sang, für die Mutter, die sie nicht umarmen konnte, für den Körper, der sie verriet, und für die Heimat Amerika, die sie vergaß. Ihre Geschichte ist eine monumentale Chronik des Rocks, die mit einem letzten, soliden, aber von Tränen getragenen Bass-Akkord endet. Suzi Quatro weigert sich, zu sterben, aber sie lebt mit dem klaren Bewusstsein, dass jede Show ihr stiller Abschied sein könnte. Die Tragödie ist jenseits von Herzzerreißend, weil sie mehr verdient hat.