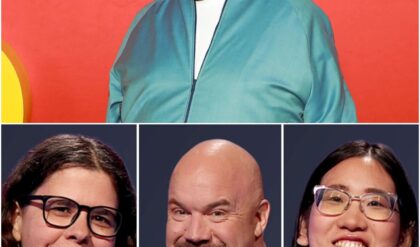Die Wahl der Richter des Bundesverfassungsgerichts gilt gemeinhin als der heilige Gral der deutschen politischen Kultur. Sie ist ein Prozess, der von größter Seriosität, taktischer Zurückhaltung und überparteilichem Konsens geprägt sein sollte. Die Besetzung der höchsten Hüter unserer Verfassung entscheidet über die Zukunft ethischer Grundfragen, gesellschaftlicher Kompromisse und die Stabilität des Rechtsstaates. Doch was sich jüngst in Berlin und in Karlsruhe abgespielt hat, gleicht weniger einer feierlichen Staatsangelegenheit als einem beispiellosen Desaster, das von politischer Dilettantischkeit, ideologischer Verblendung und einem tiefgreifenden „eklatanten Führungsversagen“ gezeichnet ist.

Im Zentrum des Sturms steht die Personalie der Bundesverfassungsrichterwahl, eine Wahl, die nicht nur eine Besetzung, sondern eine Nagelprobe für den Zustand der deutschen Volksparteien darstellt. Die Enthüllungen der letzten Wochen, insbesondere die scharfe Kritik von erfahrenen Fraktionsmitgliedern, zeichnen ein Bild von Verhältnissen, die in einer derart systemrelevanten Angelegenheit schlichtweg inakzeptabel sind. Ein ehemaliger Fraktionsvorsitzender zeigte sich öffentlich irritiert und schockiert, wie diletantisch dieser immens wichtige Prozess vorbereitet wurde. Die Tatsache, dass eine Fraktion von Montag bis Freitag in eine solche Wahl „reinstolpert“, anstatt sie mit der gebotenen Sorgfalt und politischen Absicherung zu begleiten, markiert einen Tiefpunkt politischer Organisation.
Das eklatante Führungsversagen eines Parteischwergewichts
Die direkte und vernichtende Anklage traf den damaligen Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn ins Mark. Die Kritik ist nicht nur formaler Natur, sondern zielt auf das Versagen in der politischen Verantwortung. Eine erfolgreiche Richterwahl, so betonte der Kritiker, erfordert akribische Begleitung und eine intensive Vorbereitung der Abgeordneten. Spahn, der als selbstbewusst und ungern korrigierbar gilt, wurde vorgeworfen, seine Fraktion nicht ausreichend „mitgenommen“ und den entscheidenden Prozess nicht abgesichert zu haben. Der Eindruck, der sich verfestigte, war, dass Spahn und seine engsten Vertrauten in der Führungsebene der Union im Angesicht der Krise und der innerparteilichen Rebellion ein „Geschichtskonstrukt“ geschaffen hätten, um vom eigenen organisatorischen Versagen abzulenken. Dies ist nicht nur ein Führungsfehler, sondern der Beweis, dass parteitaktische Manöver über die staatsmännische Pflicht gestellt wurden. Es ist, mit den Worten des Kritikers, ein „eklatantes Führungsversagen von Jens Spahn – wirklich“.
Die Vorwürfe wurden zusätzlich durch einen weiteren Skandal befeuert: Plagiatsvorwürfe gegen eine der vorgeschlagenen Personen. Dass eine Fraktionsführung derart wichtige Personalien vorschlägt und diese dann von Plagiatsvorwürfen im Raum stehen, während der Prozess läuft, grenzt an verantwortungsloses Verhalten. Es zeugt von einer erschreckenden Gleichgültigkeit gegenüber der Außenwirkung und der juristischen Integrität.
Der Kulturkampf um Abtreibung und Gender-Ideologie
Das wahre Beben, das diesen Skandal auslöste, ist jedoch tief ideologischer Natur und offenbart den Kulturkampf, der längst im deutschen Rechtssystem angekommen ist. Die Debatte entzündete sich an der Kandidatin Frau Brosius-Gerdorf, deren Berufung durch die Union scheiterte. Sie wurde in der Debatte als „Aktivistin“ dargestellt, deren primäres Ziel es sei, die etablierte Karlsruher Rechtsprechung zu „korrigieren“.
Konkret ging es um den jahrzehntelang „verfestigten“ „Abtreibungskompromiss“ – ein gesellschaftlicher Grundkonflikt, der einst mühsam befriedet wurde, um einen Kulturkampf zu vermeiden. Brosius-Gerdorf vertrat offenbar die Position, dass sie diesen Kompromiss anders – „anders auflösen“ – und „anders als das Verfassungsgericht es bis jetzt sagt“ regeln wolle.
Genau hier prallten die Lager aufeinander. Die Union, vertreten durch Abgeordnete wie Elisabeth Winkelmeier-Becker, stellte sich nicht etwa wegen reiner Parteiräson gegen die Kandidatin, sondern aus rein sachlichen und inhaltlichen Argumenten. Die Frage war, ob das Bundesverfassungsgericht, dessen Aufgabe es ist, das Fundament des Staates zu sichern, mit „Moralgeräte und Genderpolitik“ besetzt werden darf, oder ob es bei der reinen Rechtsdogmatik bleiben muss.
Der Ideologie-Check ging jedoch noch weiter. Es wurde die rhetorische Frage in den Raum gestellt, ob eine ehemals geräuschlose Richterin, Professorin für Jura und „Geschlechterstudien“ wie Susanne Bär, die einst auf Vorschlag der Grünen gewählt wurde und sich mit „feministischer Rechtswissenschaft“ befasste, heute überhaupt noch eine Chance hätte. Die Antwort: „Es wäre heute nicht mehr vorstellbar“. Dies zeigt, wie sehr sich das Klima in der deutschen Politik verschärft hat und wie selbst Gender Studies im Recht, einst ein akzeptiertes Feld, heute in den Verdacht der ideologischen Besetzung geraten ist.
Das „Blaue Wunder“ der „Ultra Linken“

Das Narrativ, das sich aus dieser Debatte herauskristallisiert, entspricht genau dem schockierenden Titel des Videos: Die „Ultra Linke gibt AfD Schuld an allem… erlebt dann blaues Wunder“. Die politische Linke, die oft mit einem Gefühl der moralischen Überlegenheit agiert, sieht sich selbst als Sachwalterin von Fortschritt und Gerechtigkeit. Wer ihre Position kritisiert, wird schnell in die rechte Ecke gedrängt oder als „Kampagne“ verunglimpft.
Doch das „Blaue Wunder“ der Linken besteht darin, dass der Widerstand nicht nur von „rechts außen“ kommt, sondern von der Mitte der Union und auf Grundlage juristischer Prinzipien. Die Kritik entlarvt die linke Agenda als nichts weiter als eine Politik, die am Ende nur noch aus „Moralgeräte und Genderpolitik“ besteht, ohne Rücksicht auf die existenzielle Bedeutung anderer Themen. Die sogenannte „linke Göre meint es besser zu wissen“, wird aber von den Mechanismen des demokratischen Konsens und der konservativen Verteidigung des Rechtsstaates „zurecht gewiesen“.
Die Verantwortung für diese Eskalation liegt dabei nicht nur in der ideologischen Schärfe, die von „links außen auf rechts außen“ zunimmt, sondern auch in der mangelnden Führungsstärke, die es zugelassen hat, dass dieser Kulturkampf in einer so zentralen Institution derart unkontrolliert ausgetragen wird.
Schlussbetrachtung: Ein Ruf nach politischer Verantwortung
Der gesamte Vorgang legt eine traurige Wahrheit offen: Das Vertrauen in die politische Führung und die Integrität unserer Institutionen hat massiven Schaden genommen. Der Prozess der Richterwahl, der Konsens und Überparteilichkeit erfordert, wurde zu einem Spiegelbild eines zutiefst gespaltenen politischen Berlins.
Die Frage, die bleibt, ist, wie man nach einem solchen „verantwortungslosen Verhalten“ und einem derartigen Führungsversagen das Vertrauen in die politischen Prozesse wiederherstellen kann. Es geht hierbei nicht nur um parteipolitische Ränkespiele, sondern um die Fähigkeit der Republik, ihre wichtigsten Ämter mit der notwendigen Ernsthaftigkeit und Würde zu besetzen.
Was in Karlsruhe geschah, ist eine Mahnung an alle politischen Akteure. So „korrupt“, wie der Prozess in dieser extrem systemrelevanten Wahl ablief, darf es in einer funktionierenden Demokratie nicht zugehen. Die Wähler und die Bürger haben das Recht, von ihren gewählten Vertretern zu erwarten, dass sie die „Würde des Menschen“ und die Prinzipien des Rechtsstaates über den aggressiven Zeitgeist und die kurzfristigen parteitaktischen Vorteile stellen. Die Konsequenz dieser Chaostage wird sein: „es wird ab jetzt alles anders sein bei künftigen Verfassungsrichterwahlen“. Und das ist möglicherweise das größte Unglück für die politische Kultur Deutschlands.