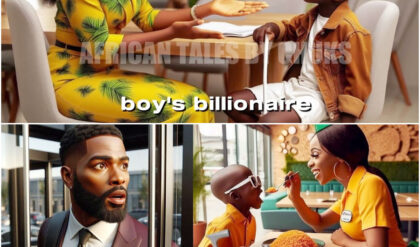Sie war das Gesicht der deutschen Nachkriegshoffnung, ein Kind mit den Augen einer alten Seele. Christine Kaufmann, geboren am 11. Januar 1945, kam nicht in einem sterilen Krankenhaus zur Welt, sondern in einer Scheune im österreichischen Lengdorf, während Europa noch in den letzten Zügen eines verheerenden Krieges lag. Ihre Geburt war ein Symbol der Instabilität jener Zeit; ihre Mutter eine französische Maskenbildnerin, ihr Vater ein Offizier der deutschen Luftwaffe. Es war ein Start ins Leben, der von Anfang an von Kontrasten geprägt war: Zerstörung und Neuanfang, Unsicherheit und eine fast unwirkliche Schönheit.
Die Familie ließ sich in München nieder, doch eine “normale” Kindheit gab es für Christine nie. Während andere Kinder zur Schule gingen, erhielt sie unregelmäßigen Privatunterricht an Filmsets. Ihre Spielplätze waren Kulissen, ihre Lehrer waren Regisseure und ihre Welt wurde durch das Ballett am Gärtnerplatztheater und später beim Staatsopernballett diszipliniert. Diese frühe Disziplin verlieh ihr eine Haltung, die sie ein Leben lang beibehalten sollte – eine Fassade der Kontrolle, die das innere Chaos verbarg.
Mit nur neun Jahren wurde sie 1954 von Regisseur Harald Reinel entdeckt. Er suchte die Hauptdarstellerin für “Rosen-Resli”, ein sentimentales Drama über ein Waisenmädchen. Christine bekam die Rolle, und der Film wurde zu einem der ersten Kassenschlager des Nachkriegsdeutschlands. Das Publikum, seelisch vernarbt vom Krieg, verliebte sich in dieses unschuldige Mädchen mit dem ernsten Blick. Sie wurde über Nacht zum Symbol für Unschuld und Erneuerung. Es folgten unzählige “Heimatfilme” wie “Wenn die Alpenrosen blühen”. Christine Kaufmann war ein Star, bevor sie überhaupt ein Teenager war.
Doch der Ruhm war ein goldener Käfig. Sie lächelte für Kameras, trug sorgfältig gestylte Kostüme, aber verpasste alles, was eine Kindheit ausmacht. Sie lernte nie, einfach nur ein Mädchen zu sein. Stattdessen wurde sie geformt von den Erwartungen der Produzenten und der Öffentlichkeit. Mit 14 Jahren traf sie eine für ihr Alter erstaunlich mutige Entscheidung: Sie zog nach Italien, um den engen Rollenbildern zu entkommen und Teil des neuen europäischen Kinos zu werden. Dieser Schritt führte sie direkt nach Hollywood – und in ihr größtes Unglück.
1961, mit gerade einmal 16 Jahren, spielte sie in “Stadt ohne Mitleid” (Town Without Pity) an der Seite von Kirk Douglas. Sie verkörperte ein deutsches Mädchen, das von US-Soldaten vergewaltigt wird und ihr Trauma vor Gericht erneut durchleben muss. Die Rolle war düster, schmerzhaft und erschütternd erwachsen. Christine spielte sie mit einer Tiefe, die Kritiker weltweit beeindruckte. Sie gewann den Golden Globe als vielversprechendste Nachwuchsdarstellerin. Hollywood lag ihr zu Füßen. Doch die Branche sah in ihr nicht nur das Talent, sondern vor allem die junge, formbare Schönheit, die man vermarkten konnte.
Dann kam “Taras Bulba” und damit Tony Curtis. Er war 36, eine etablierte Hollywood-Legende. Sie war 17, der aufstrebende Stern aus Europa. Die Affäre war ein gefundenes Fressen für die Klatschpresse. 1963 heirateten sie. Christine war gerade 18 geworden. Für die Welt war es eine Märchenhochzeit. Für Christine, wie sie später gestand, der Anfang vom Ende. “Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich Tony geheiratet habe”, sagte sie Jahrzehnte später in einem Interview. “Ich ging mit leeren Händen und weil ich kein Geld hatte, konnte er mir die Kinder wegnehmen.”

Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor, Alexandra (geboren 1964) und Allegra (geboren 1966). Doch das Glück war nur Fassade. Die Ehe zerbrach 1968, und was folgte, wurde zur zentralen Tragödie ihres Lebens. Tony Curtis erhielt das alleinige Sorgerecht für beide Töchter und brachte sie in die Vereinigten Staaten. Christine Kaufmann, der Golden-Globe-Gewinner, der Star, die Schönheit, blieb allein in Europa zurück. Der Ruhm, das Geld, die Kameras – nichts konnte sie vor diesem ultimativen Verlust schützen. Ihre Töchter, ihr Lebensinhalt, waren ihr genommen worden. Es war ein Schmerz, der sie nie wieder vollständig loslassen sollte.
Sie kehrte nach Deutschland zurück, nicht mehr als Hollywood-Glamourgirl, sondern als gebrochene Frau. Sie stürzte sich in die Arbeit, nicht um des Ruhmes willen, sondern um die unerträgliche Leere zu füllen. Sie war nicht mehr das unschuldige “Rosen-Resli”. Stattdessen fand sie ihre Nische im Neuen Deutschen Film, arbeitete mit provokanten Regisseuren wie Werner Schröter (“Der Tod der Maria Malibran”) und Rainer Werner Fassbinder (“Lili Marleen”, “Lola”). Diese Rollen waren roh, unbequem und spiegelten ihre eigene Zerbrechlichkeit wider.
1981 gelang ihr ein überraschendes Comeback. In der Kultserie “Monaco Franze – Der ewige Stenz” spielte sie die unscheinbare, aber liebenswerte Olga. Das Publikum sah eine neue Seite von ihr: Humor, Selbstironie, Wandelbarkeit. Christine Kaufmann hatte sich neu erfunden. Sie bewies, dass sie mehr war als eine verblasste Erinnerung.
Privat blieb ihr Leben turbulent. Drei weitere Ehen folgten, mit einem Regisseur, einem Musiker und einem Zeichner. Keine hielt. Die tiefen Narben, die ihre Zeit in Amerika und der Verlust ihrer Kinder hinterlassen hatten, konnte kein Mann heilen. Sie blieb unabhängig, aber im Grunde auch einsam.

In dieser Zeit fand sie eine neue Berufung. Sie begann zu schreiben. 1985 veröffentlichte sie “Körperharmonie”, ein Buch über Schönheit und bewusstes Leben. Es war ein Bestseller. Über 30 weitere Bücher folgten, zu Esoterik, Buddhismus und Weiblichkeit. Parallel baute sie sich ein zweites Standbein als Unternehmerin auf. Ihre eigene Wellness- und Kosmetiklinie, die sie über Teleshopping-Kanäle wie HSE24 vertrieb, wurde ein riesiger Erfolg. Sie wurde liebevoll “Deutschlands schönste Großmutter” genannt, ein Titel, den sie mit einem ironischen Schmunzeln trug. Sie jagte nicht der Jugend nach; sie suchte nach Wahrheit und Akzeptanz.
In ihren letzten Jahren wurde es ruhiger um sie, doch sie verschwand nie ganz. Sie gab Interviews, trat in kleinen Fernsehrollen auf und nahm mit 66 Jahren sogar an der österreichischen Version von “Dancing Stars” teil. Sie blieb elegant, scharfsinnig und stets präsent, aber zu ihren eigenen Bedingungen.
Anfang 2017 brach sie in ihrem Münchner Haus zusammen. Die erste Vermutung war eine verschleppte Grippe. Die Wahrheit war ein Todesurteil: akute Leukämie. Die aggressive Form von Blutkrebs hatte sie bereits seit Wochen unbemerkt in sich getragen. Sie wurde sofort in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert und in ein künstliches Koma versetzt. Ihre Töchter Allegra und Alexandra eilten herbei, so schnell es ging. Doch der Körper der 72-Jährigen, geschwächt von einem Leben voller Kämpfe, reagierte nicht auf die Chemotherapie. Als keine Hoffnung mehr bestand, entschieden die Ärzte, die Behandlung einzustellen und auf palliative Maßnahmen umzusteigen.
Ihre Enkelin, Dido Sergeant, schilderte später die letzten Stunden: “Sie ist gestorben, als sie allein war. Das hat uns nicht überrascht. Das entsprach ihrer Natur.” Christine Kaufmann hatte lange zuvor klargestellt, dass sie keine lebenserhaltenden Maßnahmen wünsche. Kein Drama, keine Maschinen. Nur Frieden. Ihre Tochter Allegra war bis spät in den Abend an ihrem Bett gewacht. Doch Christine starb, nachdem sie gegangen war. Still, ohne Kamera, ohne Applaus. Am 28. März 2017 wurde sie offiziell für tot erklärt.
Was folgte, war ein letzter, trauriger Akt, der die Einsamkeit ihres Lebens widerspiegelte. Ihr Begräbnis fand erst fast drei Monate später statt, am 16. Juni 2017. Es war ihr Wunsch, in der französischen Heimat ihrer Mutter, in Vernon bei Paris, im Familiengrab beigesetzt zu werden. Eine Heimkehr. Doch selbst bei dieser letzten Reise war sie allein. Ihre beiden Töchter, Alexandra und Allegra, konnten nicht dabei sein. Es war kein Zeichen von Gleichgültigkeit, sondern eine letzte, bittere Ironie des Schicksals. Alexandra, die bei einer US-Gesundheitsbehörde arbeitete, bekam keinen Urlaub genehmigt. Und Allegra wollte diesen letzten Schritt nicht ohne ihre Schwester tun. Die beiden, die als Kinder so brutal getrennt worden waren, hielten auch in diesem Moment der Trauer zusammen. Sie organisierten später eine eigene, private Gedenkfeier.
Christine Kaufmann wurde still beigesetzt, ohne öffentlichen Rummel, nur im Beisein ihres Bruders. Sie hinterließ kein großes Vermögen, keine Villen. Ihre Häuser hatte sie bereits vor ihrem Tod verkauft. Ihr Erbe war nicht materiell. Es war das Vermächtnis einer Frau, die den höchsten Ruhm und den tiefsten Schmerz kannte, die als Kind die Hoffnung einer Nation trug und als Mutter den Verlust ihres Lebensinhaltes ertragen musste. Eine Frau, die immer wieder aufstand, sich neu erfand und bis zum Schluss ihre Würde bewahrte – auch wenn sie ihren letzten Weg, so wie sie einen Großteil ihres Lebens geführt hatte, allein ging.