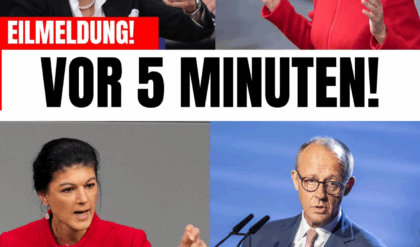Ein Gefühl der Unsicherheit schleicht sich durch die Gassen deutscher Städte. Es ist ein diffuses Unbehagen, das sich an Bahnhöfen, in Parks und nach Einbruch der Dunkelheit breitmacht. Diese Stimmung, lange als “gefühlte Unsicherheit” abgetan, wird zunehmend von harten Zahlen untermauert. Es ist der Nährboden für eine Debatte, die CDU-Chef Friedrich Merz mit seiner provokanten “Stadtbilddebatte” lostrat und die nun in einem politischen Aktionsplan gipfelt. Auf der Ministerpräsidentenkonferenz in Mainz wurde ein 8-Punkte-Plan für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum vorgestellt. Ein “Knallhart-Paket”, wie es eilig getauft wurde. Doch bei näherer Betrachtung entpuppt sich das, was als Befreiungsschlag gedacht war, für viele Kritiker als eine Sammlung alter Bekannter, praktischer Unmöglichkeiten und reiner Symbolpolitik.
Die Debatte über den Zustand unserer Innenstädte, die Merz angestoßen hatte, traf einen Nerv. Ein aktuelles ZDF-Politbarometer bestätigte, was viele spüren: Eine Mehrheit von 63 Prozent der Befragten sieht die Entwicklung des “Stadtbilds” ebenso problematisch. Die linke Empörung, die Merz’ Äußerungen folgten, und die Demonstrationen, die in den Medien teils als Massenproteste dargestellt wurden, scheinen an der Lebensrealität eines Großteils der Bevölkerung vorbeizugehen. Der Druck auf die Politik, zu handeln – und zwar sichtbar –, wurde immens. Der Mainzer 8-Punkte-Plan ist die direkte Antwort auf diesen Druck.
Doch was beinhaltet dieses Paket, das die Wende bringen soll? Es liest sich wie ein Best-of der sicherheitspolitischen Forderungen der letzten Jahre. Aber hält es einem Realitätscheck stand?

Punkt 1: Dauerhafter Ausreisearrest für Ausreisepflichtige Gefährder und Straftäter
Auf dem Papier klingt dies nach konsequenter Härte. Wer hierzulande straffällig wird oder als Gefahr für die öffentliche Sicherheit gilt und eigentlich das Land verlassen müsste, soll festgesetzt werden. Die erste Frage, die sich hier stellt und von Kritikern sofort aufgeworfen wird: Wo? Die Kapazitäten für Abschiebehaft sind bundesweit am Limit. Gefängnisse sind, wie Berichte nahelegen, zu rund 90 Prozent ausgelastet. Neue Einrichtungen zu schaffen, scheitert oft an politischen Widerständen vor Ort, wie das Beispiel Thüringen zeigt, wo ein entsprechendes Vorhaben am Widerstand der Linken scheiterte. Darüber hinaus bleibt die Frage: Warum “nur” für Gefährder und Straftäter? Was ist mit all den anderen Tausenden, die rechtskräftig ausreisepflichtig sind? Dieser Punkt wirkt bereits bei der ersten Analyse eher wie eine Absichtserklärung als ein durchsetzbarer Plan.
Punkt 2: Abschiebeoffensive nach Afghanistan und Syrien
Dieser Punkt ist ein politischer Dauerbrenner. Seit Jahren wird die Forderung nach konsequenten Abschiebungen in diese beiden Länder erhoben, insbesondere nach schweren Straftaten. Und seit Jahren scheitert sie an der Realität. Eine Abschiebung nach Afghanistan würde eine Zusammenarbeit mit dem international nicht anerkannten Taliban-Regime erfordern. Eine Abschiebung nach Syrien bedeutet, Menschen in ein Land zurückzuschicken, das von einem Diktator regiert wird, der für massive Menschenrechtsverletzungen verantwortlich ist. Die rechtlichen und moralischen Hürden sind enorm. Solange diese Grundprobleme nicht gelöst sind, bleibt die “Abschiebeoffensive” ein leeres Versprechen, das zwar den Stammtischen gefällt, aber in der Praxis wirkungslos verpufft.
Punkt 3: Schwimmbad-Betretungsverbot für verurteilte Sexualstraftäter
Nach den eskalierenden Vorfällen in öffentlichen Schwimmbädern im letzten Sommer soll diese Maßnahme für Ordnung sorgen. Doch die praktische Umsetzung wirft ein Meer von Fragen auf. Wie soll das kontrolliert werden? Der Kassierer im Freibad ist kein Polizist. Soll jeder Badegast beim Kauf einer Eintrittskarte seinen Personalausweis vorlegen? Und soll der Kassierer dann in Echtzeit eine Datenbank abfragen? Der Aufschrei der Datenschützer wäre ohrenbetäubend. Ein Straftäter könnte schlicht behaupten, seinen Ausweis vergessen zu haben oder einen falschen Namen nennen. Ohne ein lückenloses Kontrollsystem, das in Deutschland kaum durchsetzbar scheint, ist diese Maßnahme nicht mehr als ein Placebo.
Punkt 4: Verlängerung des Führungszeugnisses für Kinderschänder und IP-Adressdatenspeicherung
Der Schutz von Kindern ist ein Thema, bei dem es breiten gesellschaftlichen Konsens gibt. Die Verschärfung von Maßnahmen gegen Kinderpornografie und Missbrauch wird von niemandem ernsthaft infrage gestellt. Dieser Punkt ist der emotional stärkste und menschlich nachvollziehbarste des gesamten Plans. Doch er wird geschickt mit einem der kontroversesten Themen der deutschen Innenpolitik verknüpft: der IP-Adressdatenspeicherung. Die anlasslose Speicherung von Verbindungsdaten, auch Vorratsdatenspeicherung genannt, wurde vom Europäischen Gerichtshof mehrfach gekippt. Indem man sie nun in den Kontext der Bekämpfung von Kinderpornografie stellt, versucht man, einen “Bremsklotz” der Innenpolitik mit einem emotionalen Türöffner durchzudrücken. Ob dies juristisch Bestand haben wird, ist mehr als fraglich.

Punkt 5: Fußfessel für Frauenschläger
Gewalt gegen Frauen ist ein trauriges Dauerthema. Die Fußfessel soll Täter von ihren Opfern fernhalten. Doch ist sie ein wirksames Mittel? Eine Fußfessel hindert niemanden physisch daran, eine Gewalttat zu begehen. Sie meldet lediglich, wenn sich der Täter einer verbotenen Zone nähert. Sie ist damit ein reines Überwachungsinstrument. Kritiker vergleichen es mit gerichtlichen Kontaktverboten: Wer entschlossen ist, jemandem Schaden zuzufügen, wird sich auch von einer Fußfessel nicht aufhalten lassen. Es ist ein Symbol, das dem Opfer eine trügerische Sicherheit vorgaukeln könnte, während es den Täter in seiner physischen Handlungsfähigkeit nicht einschränkt.
Punkt 6: Einzug des Vermögens von Clan-Kriminellen
Ein weiterer Punkt, der auf dem Papier nach “maximaler Härte” klingt. Organisierte Kriminalität, insbesondere die sogenannte Clan-Kriminalität, untergräbt das staatliche Gewaltmonopol. Der Ansatz, Kriminelle dort zu treffen, wo es wehtut – beim Geld und bei den Statussymbolen wie Luxusautos und Immobilien –, ist richtig. Doch die Praxis ist zäh. In Städten wie Berlin, Bremen oder im Ruhrgebiet gab es zwar Einzelfälle, in denen Immobilien konfisziert wurden, doch oft wehren sich die Betroffenen mit einer Armada von Anwälten. Prozesse ziehen sich über Jahre, die Beweislast ist kompliziert. Die Erfolge sind oft nur Einzelfälle und kein systematischer Durchbruch. Auch hier droht der Plan, an der juristischen Realität zu zerschellen.
Punkt 7: KI-Einsatz bei Ermittlungen und Videoüberwachung
Technologie als Allheilmittel. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei Ermittlungen, etwa zur Mustererkennung oder Datenauswertung, ist unumstritten sinnvoll. Anders sieht es bei der flächendeckenden Videoüberwachung aus. Mehr Kameras im öffentlichen Raum führen unweigerlich zur alten Debatte über den “Generalverdacht”. Wird der Bürger permanent überwacht, um Taten aufzuklären, die bereits geschehen sind? Kritiker argumentieren, dass Kameras Täter oft nicht abschrecken und Prävention wichtiger sei. Statt auf Hightech zu setzen, fordern sie das, was seit Jahren fehlt: mehr präsente Polizei auf der Straße. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob eine adäquate Grenzkontrolle nicht effektiver wäre, als die Bürger im Inneren lückenlos zu überwachen.
Punkt 8: Rechtsrahmen und Aufrüstung gegen Drohnengefahr
Dieser Punkt wirkt im Kontext der alltäglichen Straßen- und Gewaltkriminalität fast schon abstrakt. Die Gefahr durch feindliche Drohnen, sei es zur Spionage oder für Anschläge, ist ein modernes Sicherheitsthema. Ein klarer Rechtsrahmen ist notwendig. Doch für den Bürger, der sich im Stadtpark unsicher fühlt, ist dies das geringste seiner Probleme. Es ist ein Punkt, der staatliche Handlungsfähigkeit im Hightech-Bereich demonstrieren soll, aber an der wahrgenommenen Bedrohungslage vieler Menschen vorbeigeht.

Die Krise des Vertrauens und was im Plan fehlt
Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) wurde im Zuge der Konferenz mit den Worten zitiert: “Das Sicherheitsversprechen (…) gegenüber unseren Bürgern ist existenziell für das Vertrauen in den Staat.” Es ist ein Satz, der das ganze Dilemma offenlegt. Denn genau dieses Vertrauen ist bei vielen Bürgern massiv erodiert. Angesichts von 2.914 Messerdelikten allein im Jahr 2024 und einer massiv gestiegenen Schusswaffengewalt in den letzten Jahren wirkt das “Sicherheitsversprechen” für viele wie Hohn.
Genau hier offenbart der 8-Punkte-Plan seine größten Schwächen: Er schweigt zu den drängendsten Problemen. Erstens: Es gibt keinen Plan für den massiven Ausbau von Gefängniskapazitäten. Solange das Justizsystem an seiner Belastungsgrenze arbeitet, verpuffen härtere Strafen. Zweitens: Es gibt keine Initiative zur Verschärfung des Strafrechts. Kritiker fordern seit Langem, dass beispielsweise ein Messerangriff nicht als “gefährliche Körperverletzung”, sondern konsequent als versuchtes Tötungsdelikt gewertet wird, um eine klare abschreckende Wirkung zu erzielen. Drittens: Der Plan bleibt bei der Ausreisepflicht vage und beschränkt sich auf “Gefährder und Straftäter”, anstatt eine umfassende Strategie für alle Ausreisepflichtigen vorzulegen.
Am Ende bleibt ein Gefühl der Enttäuschung. Der 8-Punkte-Plan ist ein Kompendium des politisch Wünschbaren, aber nicht des praktisch Machbaren. Er ist ein Dokument, das mehr Fragen aufwirft, als es beantwortet. Die Skepsis, dass dieser Plan in den 16 Bundesländern, insbesondere in denen mit rot-grüner oder schwarz-grüner Regierungsbeteiligung, jemals konsequent umgesetzt wird, ist immens.
Die Regierung hat versucht, ein Zeichen der Stärke zu setzen. Doch herausgekommen ist ein Dokument, das von vielen als “pseudomäßig tollklingend” empfunden wird. Es ist ein Plan, der die Symptome mit Symbolik behandelt, statt die Ursachen mit Substanz zu bekämpfen. Die Hoffnung, dass man bald wieder ohne Poller über den Weihnachtsmarkt schlendern oder nachts unbesorgt durch den Park gehen kann, rückt mit diesem Papier nicht näher. Es ist und bleibt eine Beruhigungspille für einen zutiefst verunsicherten Patienten, dessen Krankheit damit nicht geheilt wird.