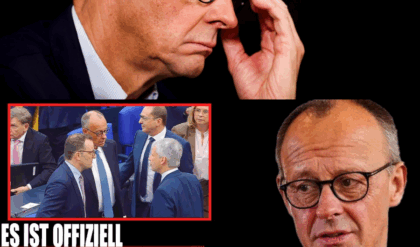„Ich habe jetzt keine Lust mehr!“ – Der Eklat um Alice Weidel: Warum die AfD-Chefin vor laufender Kamera den Dreh abbrach

Es ist ein Moment, der für Aufsehen sorgt, ein Satz, der wie ein Peitschenhieb durch die angespannte Stille schneidet: „Ich habe jetzt keine Lust mehr.“ Gesprochen von Dr. Alice Weidel, der Co-Vorsitzenden der Alternative für Deutschland (AfD) und designierten Kanzlerkandidatin. Mit diesen Worten beendet sie abrupt die Dreharbeiten für ein Porträt. Sie steht auf, dreht sich um und geht. Zurück bleiben ein verdutztes Kamerateam und ein Reporter, dessen letzte Frage den Eklat ausgelöst hat.
Was war passiert? War es die Überreaktion einer Politikerin, die mit dem Rücken zur Wand stand? Oder war es der Höhepunkt eines “kalkulierten Kreuzverhörs”, wie es Kritiker des Beitrags nennen, das von Anfang an darauf abzielte, Weidel in einem möglichst ungünstigen Licht dastehen zu lassen?
Die Szene, die zum Abbruch führte, spielte sich am Ufer des Bodensees in Überlingen ab. Ein Ort, der Weidels “Volksnähe” und ihre Verwurzelung im Wahlkreis symbolisieren sollte. Doch die Idylle war trügerisch. Das Gespräch, das harmlos begann, entwickelte sich schnell zu einem Verhör über ihre Wohnsituation.
Der Reporter wollte wissen, wie oft Weidel, die einen Hauptwohnsitz in Überlingen angibt, aber mit ihrer Familie in der Schweiz lebt, im letzten Jahr tatsächlich in ihrem Wahlkreis übernachtet habe. Eine Frage, die Weidel sichtlich unangenehm war. Sie wich aus, doch der Reporter ließ nicht locker.
Dann kam der Moment, den die AfD-Chefin als “suggestive Frage” bezeichnete. Der Reporter warf Zahlen in den Raum: „Fünf mal? Zehn mal? Zwanzig mal?“ Für Weidel war damit eine Grenze überschritten. Sie sah darin nicht den Versuch einer legitimen Recherche, sondern eine Unterstellung. Eine Provokation, auf die sie mit dem sofortigen Abbruch des Drehs reagierte.
Dieser Eklat ist jedoch nur der dramatische Schlusspunkt eines Porträts, das von Anfang an von einer tiefen Spannung geprägt war. Die Dokumentation, die eigentlich ein “harmloses Selbstporträt” sein sollte, zeichnete das Bild einer zutiefst widersprüchlichen Persönlichkeit.
Auf der einen Seite steht die beeindruckende Fassade: Dr. Alice Weidel, die Intellektuelle. Sie gehört zu den besten 5% ihres Jahrgangs, absolvierte ein Doppelstudium in Volks- und Betriebswirtschaftslehre. Sie promovierte über das chinesische Rentensystem, lebte und arbeitete in Asien. Eine Frau von Welt, die 2013 aus Eurokritik in die damals noch als “Professorenpartei” geltende AfD eintrat.
Auf der anderen Seite stehen die Kontroversen, die ihre Karriere pflastern. Da ist die berüchtigte E-Mail aus dem Jahr 2013, in der die Bundesregierung als “Schweine” und “Marionetten der Siegermächte” bezeichnet worden sein soll. Eine E-Mail, zu der Weidel bis heute jede klare Antwort verweigert. Da ist ihre komplexe Beziehung zu Björn Höcke, dem Wortführer des formal aufgelösten “Flügels”, den sie 2017 noch aus der Partei werfen wollte, dessen Unterstützung sie heute aber pragmatisch annimmt.
Der Kern des Konflikts, den die Dokumentation herausarbeitet, ist jedoch der scheinbar unüberbrückbare Graben zwischen ihrem privaten Leben und ihrer öffentlichen Rhetorik. Das Porträt folgt ihr in die Schweiz, nach Biel, das als “queer friendly, weltoffen, Multikulti” beschrieben wird. Hier lebt sie mit ihrer Partnerin und den gemeinsamen Kindern. Ein Lebensmodell, das in krassem Gegensatz zur traditionellen Familienideologie steht, die viele in ihrer eigenen Partei vertreten.
Ein ehemaliger Nachbar, der Gastronom Dino Pedolin, beschreibt sie als humorvoll, aber auch als “bissiger” im Humor. Er erinnert sich an den Moment, als sie ihm von ihrem AfD-Engagement erzählte und betonte, es ginge ihr “nur wegen dem Euro”. Derselbe Nachbar zeigt sich heute fassungslos über ihre öffentlichen Äußerungen. Wenn er die Frau, die er kannte, mit der Politikerin vergleicht, die von “Kopftuchmädchen” und “alimentierten Messermännern” spricht, sagt er: “Es ist wie als würde sie eine Rolle spielen”.
Genau diese wahrgenommenen Widersprüche nutzte das Filmteam, um den Druck auf Weidel zu erhöhen. Die Fragen zu ihrem Wohnsitz waren der Hebel, um die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen der “Bürgernähe” am Bodensee und dem Familienleben in der Schweiz, offenzulegen.

Kritiker des Beitrags, wie der YouTube-Kanal “DER GLÜCKSRITTER”, der den Vorfall analysierte, werfen dem Filmteam jedoch “unfassbare Dreistigkeit” und manipulative Methoden vor. Das, was als “offenes, ehrliches Politikerporträt” angekündigt wurde, sei in Wahrheit eine “Anklage” gewesen.
Die Analyse des Kanals wirft ein Schlaglicht auf die Arbeitsweise der Journalisten. Jede Geste, jedes Zögern von Weidel sei so montiert worden, dass es “Zweifel säht statt Einsicht schafft”. Der Ton der Fragen sei konfrontativ, die Auswahl der Szenen selektiv gewesen. Selbst bei der Erwähnung ihres exzellenten Studiums habe es noch einen “obligatorischen Seitenhieb” geben müssen.
Der Vorwurf lautet: Hier ging es nicht um Aufklärung, sondern um Vorführung. Das Publikum sollte “nicht verstehen, sondern urteilen”. Die Macher der Dokumentation, so die Kritik, hätten versucht, Weidel so lange zu schneiden, “bis sie in ein vorgefertigtes Bild passt”.
Diese Kritik gipfelt in einer medienethischen Grundsatzfrage. Der Kommentator des “GLÜCKSRITTER”-Videos stellt die rhetorische Frage, wo diese Art von “Konfrontation” eigentlich bei anderen Politikern bleibe, und nennt als Beispiel Mario Voigt (CDU) und dessen Plagiatsvorwürfe. Es wird der Vorwurf des Messens mit zweierlei Maß laut.
Der Eklat von Überlingen wird so zu einem Symptom für das zutiefst zerrüttete Verhältnis zwischen der AfD und weiten Teilen der Medienlandschaft. Für die einen ist Weidels Abbruch der Beweis für ihre mangelnde Souveränität und ihre Unfähigkeit, sich legitimen, kritischen Fragen zu stellen. Sie sehen eine Politikerin, die flieht, sobald die harmlose Inszenierung Risse bekommt und die Realität durchbricht.
Für die anderen ist dieser Abbruch ein Akt der Notwehr. Sie sehen eine Politikerin, die sich einem unfairen “Kreuzverhör” widersetzt, das nur darauf abzielt, sie zu demontieren. Sie sehen Journalisten, die nicht mehr nach der Wahrheit suchen, “statt sie zu formen”.
Am Ende, so resümiert der kritische Beitrag, verliere eine Dokumentation, die “vorgibt Einblicke zu gewähren, aber stattdessen Perspektiven verengt, ihren Anspruch auf Glaubwürdigkeit”.
Der Vorfall am Bodensee ist mehr als nur eine geplatzte Aufnahme. Er ist ein Sinnbild für eine Debattenkultur, in der es oft nicht mehr um Verständnis, sondern um Bestätigung des eigenen Weltbildes geht. Der abschließende Satz der Videoanalyse hallt nach und dient als Mahnung an beide Seiten des Grabens: „Wahrheit entsteht nicht aus Fallhöhe, sondern aus Fairness.“